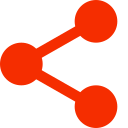E-Book, Deutsch, 152 Seiten
Eastham Raus aus der Sozialen Angst
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-432-11325-8
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Wie du am Leben teilnimmst, statt dich zu verstecken
E-Book, Deutsch, 152 Seiten
ISBN: 978-3-432-11325-8
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Zielgruppe
Gesundheitsinteressierte
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Sozialphobien und ich
Komm schon, du kannst das. Reiß dich zusammen. Du hast die ganze Nacht gerackert, du wirst das schon hinkriegen. Warum sind die immer noch nicht da? Dieser Raum ist einfach zu klein. Oh Gott, es passiert schon wieder. Mein Herz rast und mein Brustkorb schnürt sich zusammen. Warum lassen sich meine Arme nicht ganz normal bewegen? Ich werde keinen Ton rauskriegen. Ich werde bestimmt ohnmächtig. Ich werde mich zur Idiotin machen. Ich muss sofort hier raus. Das war an dem Tag, an dem ich aus einem Bewerbungsgespräch für einen Job ging, den ich wirklich haben wollte, und zwar ein paar Minuten, bevor es begann. Ich hatte (wie ich heute weiß) eine Panikattacke – die schlimmste meines Lebens. Ich sage zwar »ging«, aber es war eher ein hektisches Rennen. Ich schrie der verblüfften Personalerin ins Gesicht, ich hätte einen »Norovirus und muss unverzüglich gehen!« Keine schlechte Rede aus dem Stegreif, wenn man bedenkt, dass mein Gehirn sich in seine Einzelteile aufgelöst hatte. Ich glaube auch, dass ich niemals zuvor den Begriff »unverzüglich« verwendet habe … oder danach. Es scheint, als verfiele ich in dramatischen Situationen in eine Art Jane-Austen-Modus. War dieses Ereignis ein Schock? Nein. Ich wusste schon, bevor ich hineinging, dass etwas Schreckliches passieren würde. Ich wusste es beim Aufstehen, bei der Fahrt zur Arbeit und beim Kaffeetrinken. Das Grauen war immer da und ich wusste es, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich konnte es nicht. In den nächsten zwei Wochen war alles wie im Nebel und von Hysterie, emotionalen Ausrastern und ständiger Panik erfüllt, was mir rationales Denken unmöglich machte. Was war mit mir geschehen? Der Begriff »Angststörung« fiel das erste Mal, als ich 14 war, obwohl ich persönlich denke, dass ich sie bereits schon viel früher hatte. Als Kind graute mir vor großen Familientreffen. Ich hing dann am liebsten mit meiner Oma in der Küche herum. Sie trank Wein, qualmte eine Zigarette nach der anderen und erzählte mir Geschichten. Ehrlich gesagt hat sich auf diesem Gebiet nicht besonders viel geändert, mit dem einen Unterschied, dass ich ihr jetzt beim Trinken Gesellschaft leisten kann! In der weiterführenden Schule hatte ich sehr zu kämpfen und lief sofort dunkelrot an, wenn ich von jemandem angesprochen wurde. Meistens vermied ich die Zusammenarbeit mit anderen und befürchtete ständig, im Unterricht aufgerufen zu werden. Stellt euch mich wie einen Rauchmelder vor, der darauf präpariert ist, beim winzigsten Anzeichen von Gefahr Alarm zu schlagen. Einmal lasen wir im Englischunterricht zusammen in der Klasse Macbeth und jeder musste eine Szene laut vorlesen. Eine nette Aktion, die alle miteinbezieht, oder? Falsch, es war meine persönliche Vorstellung von Folter! Da es nach dem Alphabet ging, wusste ich schon, wann ich dran sein würde. Deshalb bekam ich in der ersten Hälfte der Unterrichtsstunde kein Wort mit, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, durchzudrehen. Obwohl ich des Lesens absolut mächtig war, konnte ich, wenn ich an der Reihe war, nicht ordentlich sprechen. Wenn ich dann so schnell ich konnte über die Worte holperte, war die Stille im Raum ohrenbetäubend. Es war furchtbar quälend und ich war davon überzeugt, dass jeder über mich lachte. Ich habe bis heute keine Ahnung, um was es in Macbeth geht. In genauso mieser Erinnerung sind mir die Rollenspiele, die wir bei unserer Französischlehrerin machen mussten. Dabei wurde eine Schülerin oder ein Schüler nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, die oder der nach vorne kommen musste, um sich mit ihren oder seinen Französischkenntnissen »hervorzutun«. Warum denken Lehrkräfte eigentlich immer, dass sowas Spaß macht? Es ist kein Spaß! Die meisten Teenager finden das im besten Falle peinlich und im schlimmsten unerträglich. Das Furchtbarste war für mich, nicht zu wissen, ob ich gewählt würde. Sobald die Lehrerin die Klasse mit ihren Augen scannte, hielt ich den Atem an und verspannte mich total. Gedanken wie »Wenn sie mich aussucht, dann sterbe ich« kreisten mir durch den Kopf. Das eine Mal, als sie mich wählte, konnte ich mit Müh und Not meinen Namen sagen und drehte im Bewusstsein durch, dass alle Augen auf mir ruhten, und meine Stimme zitterte schrecklich. Warum konnte ich mich nicht wie alle anderen Kinder damit abfinden? Um diese Zeit herum wurde mir klar, dass ich ein paar psychische Probleme entwickelte. Also tat ich, was jede und jeder empfindsame Jugendliche täte: Ich ignorierte sie (weil es immer funktioniert, ein Problem zu ignorieren, stimmt‘s?). Ich dachte, das sei die beste Methode, mit meinen Problemen umzugehen – eben indem ich mich weigerte, dass sie die Kontrolle in meinem Leben übernahmen. So schwer es auch war, so ließ ich doch nicht zu, dass sie mich daran hinderten, Freundschaften zu schließen, meine Prüfungen abzulegen, zu studieren, meinen Abschluss zu machen und einen Job anzunehmen. Es war etwas, was ich einfach durchstand. (Während meines Studiums war ich der Überzeugung, dass Alkohol gut half, aber dazu später mehr.) Als es darum ging, mich für einen Beruf zu entscheiden, wurde mir plötzlich klar, dass der Besitz eines Ladens nicht annähernd so spaßig ist wie die Kaufmannsladenspiele, die ich als Kind mit meinem Bruder so mochte. Meine Liebe zu Büchern führte mich in Richtung Verlagswesen und ich war bereit, für dieses Ziel hart zu arbeiten. Ehrlicherweise ist es für ein Mädchen aus der Arbeiterklasse, das nicht aus London stammt, nicht gerade einfach, einen Job in einem Verlag oder in den Medien zu ergattern. Es wird Erfahrung verlangt, die nicht leicht zu erlangen ist, wenn man 300 Meilen entfernt wohnt. Also machte ich einen Masterabschluss in Verlagswesen und begann dann in einem bekannten Verlagshaus ein einmonatiges Praktikum. Es war seltsam, so lange von zu Hause weg zu sein, aber ich freute mich über diese Gelegenheit. Während meines Praktikums wohnte ich in einem Hostel, das von zugedröhnten Backpackern und äußerst selbstbewussten nackten deutschen Frauen frequentiert wurde. (»Wäre es zu viel verlangt, wenn ich Sie darum bäte, sich ab sieben Uhr morgens etwas überzuziehen?« Anscheinend schon.) Es war ein abweisender, schäbiger Ort, doch ein Hotel konnte ich mir nicht leisten. Sagen wir mal so: Ich weinte sehr viel in diesen Wochen! Nichtsdestotrotz war das Praktikum für mich eine sehr positive Erfahrung, für die sich das Wohnarrangement gelohnt hatte. Die Arbeit machte mir Spaß und die Atmosphäre war leidenschaftlich und elektrisierend. Es bestätigte mich darin, dass der Verlagsbereich das Berufsfeld war, in das ich einsteigen wollte. Aus diesem Grund konnte ich es vor Freude kaum fassen, als mir ein paar Monate später im selben Verlagshaus ein Vollzeitjob angeboten wurde. An einem sonnigen Tag im März zog ich dann von Bolton nach London. Kannte ich dort jemanden? Nein. Hatte ich vorher schon viel Zeit in London verbracht? Nicht so richtig. Fühlte ich mich dabei wohl, aus dem wohlbehüteten Nest zu ziehen, um mir für 680 Pfund im Monat ein Haus mit zwei völlig Fremden zu teilen? Sch**ße nein! Hört mir bloß mit den Londoner Preisen auf! Echt, lasst es. »Kriegsneurose« würde es nicht mal annährend beschreiben. Damals sagten mir die Leute, für wie mutig und furchtlos sie das hielten, aber ich selber empfand das überhaupt nicht so. Warum nicht? Ganz einfach: Ich verweigerte mich völlig der Tragweite meiner Entscheidung. Es war zu viel zu verarbeiten, also sprang ich an der tiefsten Stelle kopfüber rein und paddelte wie wild. Es begann zunächst ziemlich gut. Meine Mitbewohnerinnen waren nett, ich machte mich mit dem U-Bahn-System vertraut (für alle Fälle) und holte mir jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee bei Starbucks, genauso wie im Film (für ein Kleinstadtmädchen war das das Coolste überhaupt). Ich hatte sogar sechs Wochen nach meiner Ankunft schon einen Freund – jemanden, der überhaupt nichts über meine Vergangenheit wusste (und ich hatte auch vor, es dabei zu belassen). Offiziell lebte ich einen Traum! Die schlimmen Zeiten lagen hinter mir und ich war nun ein neuer Mensch … oder? Sechs Monate nach meiner Ankunft begann ich, einige Veränderungen in mir selbst festzustellen. An vier von fünf Arbeitstagen war ich unglücklich, reizbar und lethargisch. Die Abteilung, in der ich zu dieser Zeit arbeitete, war voll mit lauten, dominanten Menschen, wodurch ich mich unbehaglich fühlte und angespannt war. Eine extrovertierte Persönlichkeit tut sich hervor, um bemerkt zu werden, wogegen ich mehr zu den introvertierten gehöre (nicht mit Schüchternheit zu verwechseln!). Es gab so viele Publikumsveranstaltungen, bei denen meine Anwesenheit erwartet wurde, und ich fürchtete sie wie diese Familientreffen. Doch diesmal gab es keine Oma, die mich retten konnte. Stattdessen war ich auf mich allein gestellt, in einem Meer von hellen Lichtern und fremden Gesichtern. Langsam wurde ich von dem Gedanken besessen, was die Leute über mich denken mögen und wie ich mich darstellte. Ich wollte mich zwar damit nicht befassen, konnte mich aber nicht zusammenreißen. Ich analysierte sogar, wie ich den Flur entlanglief. Ich entwickelte eine Phobie. Sollte ich die Leute anlächeln? Sollte ich zu Boden schauen? Was? WAS? Mit der Zeit bekam ich Gesichtskrämpfe, wenn jemand an mir vorbeiging! Aufzüge waren ein weiteres Problem: Ich konnte den Gedanken an eine gezwungene Unterhaltung mit Kolleginnen und Kollegen nicht ertragen. Letztlich führte das dazu, dass ich jeden Tag sieben Stockwerke Treppen stieg. Ein prima Training, aber schweißintensiv! Auch die Mitarbeiterküche war ein Minenfeld – nie...