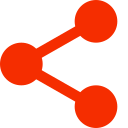E-Book, Deutsch, 240 Seiten
Engel Die 7 Prinzipien des Tatortreinigers
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-7453-1398-7
Verlag: riva
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Geschichten über Mord, Gewalt, Liebe und Hoffnung
E-Book, Deutsch, 240 Seiten
ISBN: 978-3-7453-1398-7
Verlag: riva
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Hinter jedem Tatort steht ein menschliches Schicksal, das Spuren hinterlässt. Marcell Engel ist seit über 25 Jahren Tatortreiniger und täglich mit diesen Spuren konfrontiert. Was geschah an dem Ort, an den er gerufen wurde?
Engel beschreibt in seinem Buch sieben Crimescenes – Anzeichen von Gewalt und Zerstörung, zerbrochene Schicksale, kurz: wahre Begebenheiten. All diese Geschichten zeigen, wie festgefahren Menschen oft sind und wie wenig in der Lage, negative Einflüsse aus ihrem Leben zu verbannen. Was er entdeckt und erfährt, macht ihn betroffen und bringt ihn zum Nachdenken – über den Sinn des Lebens und sich selbst. Seine Gedanken münden in sieben Prinzipien. Es sind Weisheiten, die uns lehren, ein Leben fernab von Schmerzen und Angst zu führen, unseren Alltag mit Disziplin zu bewältigen, richtige Entscheidungen zu treffen und stets unseren eigenen Weg zum Glück zu suchen.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
KAPITEL 1
ANGST
Der Tatort – das Horrorhaus
Seit jeher haben Menschen Angst. Ein Urtrieb, vor dem es kein Entkommen gibt. Angst vor der Dunkelheit, dem Ungewissen, dem Unerklärlichen. Manchmal steckt die Angst auch in einem ganz normalen Tag. Ich gehöre nicht zu den ängstlichen Menschen, fürchte mich grundsätzlich vor nichts und niemandem. Stelle mich selbstbewusst jeder Situation. Doch an diesem Tag, den ich nie vergessen werde, hat sie auch mich gepackt – die Angst. Es war ein drückend schwüler Sommertag Anfang der 2000er, das Thermometer zeigte weit über 30 Grad Celsius an. Ich sehnte schon langsam den Feierabend herbei, um der Hitze zu entkommen und es lag eine allgemeine Trägheit in der Luft. Das Schrillen des Telefons riss mich in diesem Moment aus meiner Schreibtischarbeit. Wie fast immer kündigte das Läuten einen neuen Auftrag an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich, der Stimme nach, ein noch junger Mann: »Sie müssten hier mal vorbeikommen und eine Reinigung vornehmen. Es geht hier darum, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.« Mehr als diese kryptischen Informationen erhielt ich vorerst nicht. Der Satz, dass es um die öffentliche Ordnung ging, ließ jedoch meine inneren Alarmglocken anspringen. Immer wenn diese Wendung benutzt wird, ist klar, dass mehr im Busch ist als nur eine »normale« Reinigung. Ich stellte mich gespannt darauf ein, weitere Informationen zu erhalten. Doch nichts – ratlos starrte ich noch einige Minuten auf den Telefonhörer. Aber mehr, als dass es sich um einen Leichenfund handelte und das Haus lange Zeit von niemanden betreten wurde, erfuhr ich nicht. Es war mir zunächst schleierhaft, wie das die öffentliche Ordnung gefährdete. Ich erhoffte mir, dass der Auftraggeber vor Ort bei der Schlüsselübergabe noch mehr zum Geschehen sagen würde. Ohne zu wissen, was genau dieser Fall für mich bereithalten würde, machte ich mich mit meiner damaligen Auszubildenden Diana kurze Zeit später auf den Weg in einen beschaulichen Frankfurter Vorort. Während der Fahrt begann mein Gedankenkino und die wildesten Theorien geisterten in meinem Kopf umher. Mit jeder Minute stieg die Anspannung. Was würde uns dort erwarten? Wir fuhren an einer Reihe gepflegter Einfamilienhäuser vorbei, freundlich einladende Fassaden von älteren Häuschen wechselten sich mit den glatten Fronten moderner Neubauten ab. Wäre ich hier nur zu Besuch gewesen, würde ich mich durchaus wohlfühlen. Langsam fuhren wir weiter die idyllische Straße entlang, bis zur gesuchten Hausnummer. Ein Blick aus dem Fenster offenbarte ein für diese Gegend typisches Haus. Allerdings wirkte es im Gegensatz zu den gepflegten Nachbarhäusern verwahrlost. Noch war mir nicht bewusst, welches schreckliche Geheimnis es im Inneren für uns bereithielt. Ich öffnete die Autotür und trat in die heiße Luft hinaus. Kurz darauf kündigten Reifengeräusche unseren Auftraggeber an. Er sprang aus dem Auto, wandte sich an uns mit den Worten: »Hier ist der Schlüssel, wenn es Probleme gibt, anrufen« – und schon war er wieder verschwunden. Dort standen wir also mit dem Schlüssel in der Hand, ohne Details, ohne konkrete Anweisungen. Ich lächelte Diana noch zuversichtlich an, bevor wir die kleine Gartenpforte erreichten. Eine kleine Steinmauer, auf dessen Schultern ein Metallzaun mit kleinen Säulen thronte, säumte den Vorgarten. Rechts neben dem Haus erstrecke sich ein großer Platz mit Garage. Im Gegensatz zu den Nachbarhäusern war dieses Gebäude extrem weit nach hinten in den Garten versetzt und vor Blicken gut geschützt. Der Zahn der Zeit hatte auch hier mit aller Vehemenz genagt – alles präsentierte sich im fortgeschrittenen Stadium des Verfalls. Über dem Vorplatz befand sich zu Teilen eine Pergola, die ihren einstigen Glanz längst verloren hatte. Wilder Wein wucherte über die einzelnen Holzbalken und verschlang sie regelrecht. Unter dem Holzgang stand nicht etwa eine schöne Sitzgruppe, die auf ein Glas Wein einlud, sondern es stapelten sich Müll und Unrat. Mülltüte über Mülltüte, gelbe Säcke, Kleidung und vieles mehr lag in einem riesigen Chaos durcheinander. Rechts neben der Pergola befand sich ein kleiner Aufgang zum Haus, davor gelagert ein nachträglich angebauter Windfang. Langsam stiegen wir die wenigen Stufen der ausgetretenen Steintreppe empor. Sie führte uns vorbei an noch mehr wildem Wein, der uns seine Blätter entgegenstreckte. Die Tür bestand aus Milchglas und verwehrte durch einen vorgezogenen Vorhang den Blick in das Innere. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir versuchten, mit dem Schlüssel die Tür zu öffnen, doch das ersehnte, leise Klicken blieb aus. Das Schloss klemmte. Ich rief mir noch einmal kurz die Worte unseres Auftraggebers ins Gedächtnis: »Wenn es Probleme gibt, anrufen.« Ein sanftes Öffnen der Tür war schlicht nicht möglich. Je länger wir dort standen und versuchten, das Schloss doch noch dazu zu bringen, nachzugeben, desto angespannter wurde die Stimmung. Ein seltsames Gefühl durchzuckte mich plötzlich, etwas, das man nicht beschreiben kann. Vielleicht war es eine dunkle Vorahnung, die Intuition, jetzt besser das Weite zu suchen. Es war, als würde mein Körper schon wissen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Irgendwie spooky Diana erkundete derweil das Grundstück, um eventuell einen zweiten Eingang zu finden, den wir übersehen hatten. Beim Rundgang zeigte sich, dass jedes Fenster zur Straße hin mit massiven Holzrollläden verbarrikadiert war. Hier war kein Durchkommen möglich – der hintere Teil des Hauses gab noch einen Kellerabgang preis. Müllberge und meterhoch gestapelter Unrat versperrten jedoch auch hier den Weg. Es war fast so, als würde das Haus nicht wollen, das wir hereinkommen. Obwohl dieses Einfamilienhaus nicht wirkte, als sei es einem Horrorfilm entsprungen, so war es doch von einer seltsam mysteriösen Aura umgeben. Der Blick in den Garten zeigte, dass sich hier die Natur langsam, aber sicher, ihr Territorium zurückerobert hatte. Alles von Menschenhand Geschaffene verschwand unter einem grünen Teppich, die Betonplatten, die den Weg in den Garten einfassten, ließen nur noch schemenhaft erahnen, wie es hier einmal gewesen sein musste. Ich horchte mit einem Mal auf und … nichts. Kein Vogelgezwitscher, keine fröhlich spielenden Nachbarskinder, kein Hundegebell. Nicht einmal das Surren von Insekten war zu hören. Der verwahrloste Zustand des Hauses war eine Sache, doch diese Totenstille um diese Uhrzeit am Nachmittag in einem sonst belebten Vorort war wirklich unheimlich, ich fühlte mich kurzzeitig wie in Stephen Kings Roman Die Arena, gefangen unter einer Glaskuppel, die nichts nach außen dringen lässt, aber auch nichts nach innen. Ich wandte mich an Diana. »Irgendwie fängt der Auftrag ein bisschen spooky an.« Sie stimmte mir lächelnd zu. Es war zweifelsohne ein bisschen seltsam, aber noch lange kein Grund, um in Panik zu geraten. Als klar war, dass wir nicht so einfach in das Haus kommen würden, rief ich unseren Auftraggeber an und fragte, ob wir zur Not auch etwas Gewalt anwenden dürften, um das Türschloss aufzubrechen. Als dieser bejahte, holte ich mein Werkzeug und brach die Tür auf. Gemeinsam traten wir in den vorgelagerten Windfang des Hauses ein. Auch hier führte sich fort, was sich schon vor dem Haus angedeutet hatte. Müll und noch mehr Müll. Ich blickte mich um und erkannte drei Garderobenständer, die über und über mit Kleidung bedeckt waren: Jacken, Pullover, Hosen und oben auf den Haufen gestapelt jede Menge Baseballcaps, Mützen und Hüte. In dem Lichtschein, der von draußen hereindrang, präsentierten sich zudem Hunderte filigran durch den Raum laufende Spinnweben. Staubkörner tanzten in dem Luftstrom, den wir mit unserem Eindringen verursacht hatten. Freiwillig hätte ich ein solches Haus wohl nie betreten. Unter meiner kompletten Schutzkleidung begann ich mehr und mehr zu schwitzen, ich merkte, wie mir die Schweißperlen den Rücken herunterliefen, draußen waren es mittlerweile locker über 30 Grad und im Inneren des Hauses bestimmt nochmal zehn mehr. Als wäre das nicht schon genug, schlug uns beim Betreten ein extremer Leichengeruch entgegen. Sogar durch die Schutzmasken hindurch, die mit ihrem Kohlefilter eigentlich dafür sorgen, solche Gerüche fernzuhalten, nahmen wir den süßlichen Geruch des Todes wahr. Diesen Geruch vergisst man nicht. Schafft er es, durch die Masken zu dringen, ist das ein untrügliches Anzeichen dafür, dass das, was kommt, extrem sein wird. Es würde ein richtig harter, abgefuckter Tag werden. Dunkelheit und Ungeziefer Im Vorraum diente uns zunächst nur das einfallende Licht aus der Eingangstür zur Orientierung. Unsere Taschenlampen waren zwar griffbereit, aber damals noch weit entfernt von modernen LED-Leuchten – man hätte genauso gut ein Feuerzeug anzünden können,...