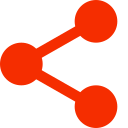E-Book, Deutsch, 271 Seiten
Grave Bild und Zeit
1. Auflage 2022
ISBN: 978-3-406-78470-5
Verlag: Verlag C. H. Beck GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Eine Theorie des Bildbetrachtens
E-Book, Deutsch, 271 Seiten
ISBN: 978-3-406-78470-5
Verlag: Verlag C. H. Beck GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Können Bilder Macht auf ihre Betrachter ausüben? In seiner neuen Bildtheorie zeigt Leibniz-PreisträgerJohannes Grave, dass Bilder uns in zeitliche Prozesse verstricken, die sich nicht vollständig kontrollieren lassen, aber neue Denkräume eröffnen. Vor allem durch ihre Struktur und Gestaltung beeinflussen Bilder die Wahrnehmung und damit auch unsere Zeiterfahrung erheblich. Das Buch ist ein Plädoyer dafür, sich beim Blick auf Bilder Zeit zu nehmen und sich ganz in ihren Bann ziehen zu lassen.
Bei der Betrachtung von Bildern wird dem Faktor Zeit meist keine besondere Bedeutung beigemessen. Anders als bei einem Text scheint beim Bild alles auf den ersten Blick gegenwärtig zu sein. Tatsächlich aber sind in Bildern verschiedene Zeitebenen miteinander verschränkt – so z. B. die Zeitspanne, die man vor dem Werk verbringt, die im Bild dargestellte Zeitlichkeit oder die Alterung des Bildträgers. Die Wahrnehmung von Bildern lässt sich daher nicht als simultane Schau eines gegebenen Ganzen verstehen, sondern vollzieht sich in einer eigenen Zeit. Dabei kann das Sehen vorgezeichneten Spuren folgen oder auch aus einer Fülle von Angeboten auswählen. Johannes Grave geht der Frage nach, wie Bilder die Zeit ihrer Betrachtung auf eine Weise beeinflussen, die sich vom Blick auf andere Dinge und von der Lektüre eines Textes unterscheidet.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
ZU DIESEM BUCH
«Nicht alles ist zu allen Zeiten möglich»,[1] hielt Heinrich Wölfflin 1915 in seinen Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen fest, um die Einsicht zuzuspitzen, dass die künstlerischen Darstellungsformen und vor allem das Sehen einer geschichtlichen Veränderung unterliegen. Mit guten Gründen erwartet man von der kunsthistorischen Forschung eine besondere Sensibilität für die historische Bedingtheit von Kunstwerken und Phänomenen der visuellen Kultur. Bereits im Namen der Disziplin scheint sich ein Bekenntnis zur Geschichtlichkeit von Kunst zu äußern. Dabei ist neben der Wandelbarkeit von Darstellungs- und Wahrnehmungsstilen auch an die Historizität des Bildverständnisses und nicht zuletzt des Kunstbegriffs zu denken. Insofern muss sich die Kunstgeschichte selbst als ein historisches Phänomen begreifen: Der Kern ihrer Praxis – die Erforschung von menschlichen Artefakten als Kunstwerken mit eigener Geschichte – ruht auf Voraussetzungen, die ihrerseits historisch bedingt sind. Es ist daher eher irritierend und erklärungsbedürftig, wenn eine Kunsthistorikerin oder ein Kunsthistoriker an Zeugnissen weit auseinanderliegender Epochen sehr ähnliche Beobachtungen macht. Wenn Objekte, die unter gänzlich unterschiedlichen Bedingungen entstanden sind, überraschende Verwandtschaften aufweisen sollen, liegt der Verdacht nahe, dass sich der vermeintliche Befund lediglich einer anachronistischen Rückprojektion oder gar einer persönlichen Idiosynkrasie verdankt. Ein solcher Verdacht stand am Anfang dieses Buches, das auf eine beunruhigende Selbstbeobachtung zu antworten versucht: Im Zuge meiner eigenen kunsthistorischen Arbeiten war mir nach und nach aufgefallen, dass ich in meinen Analysen unterschiedlicher Bilder zu durchaus vergleichbaren Ergebnissen kam. Sowohl bei Studien zur italienischen Malerei der Frührenaissance als auch in meinen Arbeiten über die Kunst um 1800 stieß ich immer wieder darauf, dass ich in Bildern interne Spannungen oder Widersprüche zu beobachten meinte, die darauf drängen, in einem zeitlichen Prozess der Betrachtung ausgetragen zu werden. Natürlich erweisen sich die Umstände, die mutmaßlichen Zwecksetzungen und die konkreten Umsetzungen dieser bildinternen Widerstreite als sehr unterschiedlich. Und dennoch scheint diesen Fällen gemeinsam zu sein, dass sie mit Wahrnehmungsangeboten konfrontieren, die den Betrachter dazu anregen, im Verlauf einer längeren Bildrezeption sehr verschiedene Eindrücke zu gewinnen. 1. Bartolomeo Montagna, Noli me tangere, um 1490–1500, Öl auf Holz, 160 × 172 cm, Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie An zwei recht beliebig herausgegriffenen Beispielen lässt sich dieser Befund kurz veranschaulichen: Ein Altargemälde Bartolomeo Montagnas (Abb. 1) spielt regelrecht mit verschiedenen Wahrnehmungen und Suggestionen, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen.[2] Zunächst stellt sich der Eindruck ein, dass unser Blick durch eine arkadenartige Architektur in eine Landschaft geführt wird, in deren Zentrum die Begegnung des auferstandenen Christus mit Maria Magdalena erscheint. Doch wird diese Sichtweise plötzlich fraglich, wenn das Auge auf die äußerst flachen Pilaster trifft, die mit auffällig weit vorkragenden Konsolen die schweren Bögen tragen sollen. Denn die Logik der Architektur macht es hier zweifellos erforderlich, dass sich unmittelbar hinter den Pilastern, die im Deutschen ja nicht ohne Grund als Wandpfeiler bezeichnet werden, eine Mauer befindet. Damit aber erweist sich die zentrale Szene mit dem Auferstandenen als ein Bild im Bild, d.h. als äußerst kunstvolle illusionistische Malerei, die eine Wand verdeckt, auf der wiederum die Pilaster aufliegen. Doch selbst wenn der Betrachter diese Schlussfolgerung aus der architektonischen Logik gezogen hat, lässt sich der Eindruck, die mittleren Bildfiguren seien gleichermaßen ‹real› und ‹lebendig› wie die beiden Heiligen in der schmalen vorderen Raumzone, nicht gänzlich verdrängen. Denn zum Beispiel der Kardinalshut des Heiligen Hieronymus und der ihn begleitende Löwe finden in der Landschaft ihren Platz. Montagna legte es offenkundig darauf an, zwei miteinander widerstreitende Eindrücke anzuregen, denen nur nacheinander oder im Wechsel, mithin in einem zeitlichen Prozess, Rechnung getragen werden kann. Bei einer eingehenderen Beschäftigung mit der religiösen Funktion des Gemäldes und mit der spezifischen Problematik der dargestellten Szene lassen sich für diese ungewöhnliche Lösung gute Gründe anführen. Denn der einzigartige Status des auferstandenen Christus, der den religiösen Kern des dargestellten Themas ausmacht, lässt sich nicht einfach vergegenwärtigen; er kann nur vermittelt werden, wenn sich der Betrachter der Erfahrung des im Bild angelegten Widerspruchs aussetzt. Mit der hier skizzierten Strategie stand Bartolomeo Montagna in der frühen Renaissance keineswegs allein. Das vielfach beobachtbare Spiel mit Widersprüchen und Paradoxien könnte man daher als eine frühe Reaktion auf die gerade erst erschlossenen neuen Möglichkeiten der Linearperspektive verstehen. Die Perspektive erlaubte es, das im Bild Dargestellte dem gewohnten Erscheinungsbild von Menschen oder Gegenständen in der Wirklichkeit anzunähern. Durch gezielte logische Brüche oder andere bildinterne Widerstreite konnte aber auch unter diesen neuen Voraussetzungen weiterhin die Differenz zwischen Bild und Realität geltend gemacht werden. 2. Philipp Otto Runge, Die Lehrstunde der Nachtigall (zweite Fassung), 1804/05, Öl auf Leinwand, 104,7 × 85,5 cm, Hamburger Kunsthalle Allerdings lassen sich vergleichbare Widerspruchserfahrungen, die nur im zeitlichen Vollzug der Betrachtung ausgetragen werden können, auch an Bildern aus ganz anderen Zeiten machen, die sich völlig anderen Themen zuwenden. Philipp Otto Runges Gemälde Die Lehrstunde der Nachtigall (Abb. 2) hat offenkundig weder von der Zweckbestimmung noch vom Themenkreis her – Runges Bild nimmt auf eine gleichnamige Ode von Friedrich Gottlieb Klopstock Bezug – Gemeinsamkeiten mit dem Altarbild Bartolomeo Montagnas.[3] Dennoch meine ich auch in diesem Fall bildinterne Spannungen auszumachen, die dem Betrachter den zeitlichen Prozess der Bildrezeption bewusst machen können. In dem ovalen Binnenbild stellt Runge die Nachtigallenmutter und ihr Kind dar, um jene Lehrstunde im Singen bzw. Flöten vor Augen zu führen, von der Klopstocks Ode handelt. Doch zeichnen sich bereits auf einer rein inhaltlichen Ebene Widersprüche ab, wenn man in den auf der schmalen Rahmenleiste des Binnenbildes geschriebenen Versen Klopstocks von einer Aufforderung zum Flöten erfährt, während im Bild selbst die Hand der Mutter das Kind am Musizieren hindert. Mindestens ebenso wichtig sind Spannungen anderer Art. Das Binnenbild lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Dargestellte: Mutter und Kind sind plastisch herausgearbeitet, ihre Umgebung weist Räumlichkeit auf. Der Blick wird mithin in einen Bildraum geführt, damit er sich dort auf die beiden zentralen Figuren konzentrieren kann. Eine völlig andere Blickregie und Erfahrung impliziert jedoch der Rahmen. Vor allem die vergleichsweise kleine Schrift auf der inneren Rahmenleiste hat hier erhebliche Folgen für die Bildbetrachtung. Sie veranlasst den Betrachter, von einer mittleren Sehdistanz in eine Nahsicht zu wechseln, verlangt ihm für die Lektüre der Verse halsbrecherische Kopfbewegungen ab und stößt ihn durch die ungewöhnliche Nähe des Auges zum Gemälde nicht zuletzt auf die Bildfläche mit ihrer eigenen Materialität. Statt eines Bildraumes mit plastischen Figuren drängt sich nun der Bildträger, die bemalte Leinwand, in den Fokus. Tritt der Betrachter anschließend wieder zurück, so konzentriert sich der Blick erneut auf das im Bild Dargestellte. Runge spielt also wie Bartolomeo Montagna damit, dem Betrachter im Verlauf des Rezeptionsprozesses sehr unterschiedliche, ja miteinander konkurrierende Erfahrungen zu eröffnen. Auch in diesem Fall lassen sich spezifische Gründe dafür anführen, warum dem Maler an einem solchen Vorgehen gelegen sein konnte. Die widersprüchlichen Eindrücke, die ein aufmerksamer Betrachter sammelt, stoßen ihn darauf, dass sich auch sein eigenes Tun, das Sehen, in einem zeitlichen Prozess vollzieht, so dass sich die Malerei, die vermeintlich auf einen Augenblick beschränkt ist, als eine der Dichtung ebenbürtige Zeitkunst erweist. Auf diese Weise kann Runges Gemälde mehr für sich in Anspruch nehmen, als nur eine schlichte Illustration von Klopstocks Ode zu sein. Es erweist sich als eine Dichtung mit den Mitteln der...