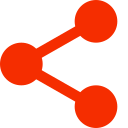Jamison Der Gin-Trailer
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-446-26506-6
Verlag: Hanser Berlin in Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 352 Seiten
ISBN: 978-3-446-26506-6
Verlag: Hanser Berlin in Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Drei Generationen von Frauen versuchen verzweifelt einander zu retten. Nach dem New-York-Times-Bestseller "Die Klarheit" schreibt Leslie Jamison auch in ihrem ersten Roman über Sucht.
Als junge Frau läuft Tilly von zu Hause weg und landet in der schäbigen Unterwelt Nevadas, wo sie statt des großen Glücks nur Drogen, Alkohol und die falschen Männer findet. Eines Tages, nachdem Tilly beinahe dreißig Jahre lang keinen Kontakt zu ihrer Familie hatte und sich in einem Trailerpark in der Wüste fast zu Tode getrunken hat, steht ihre Nichte vor der Tür ihres Wohnwagens und zwingt sie zu einem Neuanfang. Der Gin-Trailer erzählt die Geschichte der eigentümlichen Beziehung, die zwischen den beiden entsteht. Ein großer Roman über Sucht und Ausweglosigkeit, über echte Verzweiflung und die flüchtigen hellen Augenblicke, die so schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.
Weitere Infos & Material
STELLA
An Weihnachten fand ich Oma Lucy. Sie war gestürzt und lag auf dem Linoleum. Der Kühlschrank hinter ihrem nackten Körper brummte wie Todesrasseln. Zwischen ihren Fäusten hielt sie zusammengeknüllte, blutige Taschentücher. Aber sie war am Leben und sprach. »Ich wollte mir nur einen kleinen Joghurt holen«, sagte sie. »Da habe ich Nasenbluten bekommen.« Ihre Hände ruderten durch die Luft und suchten nach Haltegriffen, Fingern, irgendwas. Zum ersten Mal sah ich ihren Körper ganz — ihre herunterhängende Geisterhaut und das blaue Geäder darunter. Mit dem Zug war ich durch den eisig kalten Winter von Connecticut gekommen, ein Stück Honigkuchen und ein dick mit ihrem fettigen Lieblingsschinken belegtes Sandwich im Gepäck. Und mit einer Tasche voller Geschenke. Vom Fußboden aus wollte sie wissen: »Sind die für mich?« Sie zitterte. So hatte ich sie noch nie gesehen, wie sie ohne Unterlass in die Luft griff und fasste. Ihr Gesicht zuckte, so als ob sie es ruhig zu halten versuchte, während untendrunter irgendetwas vor sich ging. Sie nahm meine Hand. Ihre Finger waren voller Creme und schmierig. »Matilda soll kommen«, sagte sie mit ruhiger, fester Stimme, als ob dieser Wunsch vollkommen naheliegend wäre. Von einer Matilda hatte ich noch nie gehört. Ich fasste sie am Handgelenk und schob die andere Hand unter ihren Buckel. Die Haut zwischen den knochigen Knubbeln ihrer Wirbelsäule war schlaff. »Reiß nicht so an mir«, sagte sie. »Das tut weh.« Ich rief meinen Bruder Tom an. Der meinte: »Du musst sie fragen: Lucy, hast du dir den Kopf gestoßen?« Ich legte die Hand über den Hörer und wartete auf ihre Antwort. Und er wartete auf meine. »Es war doch nur der Joghurt«, sagte sie. »Ich wollte nur ein kleines bisschen Joghurt.« Ich kniete mich neben sie. Meine Stiefel quietschten auf dem Linoleum. »Aber hast du dir denn den Kopf gestoßen? Kannst du mir das sagen?« Sie sagte: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich erinnern würde, falls es so wäre.« Das berichtete ich Tom. Er meinte, ich solle sie mindestens zwei Stunden wach halten. Er erinnerte sich daran, dass man das tun musste, wenn der Verdacht auf Gehirnerschütterung bestand. Er war gerade zusammen mit unserer Mutter Dora auf der anderen Seite des Landes. Wahrscheinlich nippte er in einem Restaurant an der Pazifikküste, wo alle fröhlich unerschüttert über ihr Sushi nachdachten, an einem Glas Mineralwasser. Er erzählte mir, die Besitzer des Lokals seien Einwanderer der ersten Generation und hätten zum Glück über die Feiertage geöffnet. Es sei seit Monaten der erste Tag, an dem meine Mutter sich frei nehme. »Tom?«, fragte ich. »Kennst du vielleicht jemanden, der Matilda heißt?« »Sekunde«, sagte er, »ich geb’ dir mal Mom.« Laut und plötzlich hörte ich ihre Stimme: »Du musst wirklich tun, was Stella sagt! Du musst zulassen, dass sie sich um dich kümmert!« »Versuchst du gerade, mit Oma zu reden?«, fragte ich. »Soll ich dich vielleicht mal weiterreichen?« »Oh«, sagte sie, »ja, natürlich.« Mit zitternden Fingern griff Oma Lucy nach dem Telefon. Meine Mutter sprach so laut, dass es klang, als käme ihre Stimme aus dem Fußboden unter Oma Lucys Ohr. Oma Lucy rollte sich auf die Seite und gab mir das Telefon. Tom sagte: »Zwei Stunden, verstanden?« Im Hintergrund hörte ich Geräusche, das Klirren von Gläsern und Stimmengewirr. Ich legte auf. Oma Lucy wollte weder Honigkuchen noch Tee. Geschenke wollte sie auch nicht. Sie wollte nur ins Bett und schlafen. Es war noch nicht dunkel und würde es auch noch lange nicht sein. Aber sie beharrte darauf: Der Tag sei im Eimer. Sie wolle lieber morgen früh aufstehen und dann Weihnachten feiern. Ich sah auf die Uhr. Holte tief Luft. Zwei Stunden: Das würde ich schaffen. Wir fanden eine Weihnachtssendung im Fernsehen. Animierte Rentiere aus Knetmasse trappelten über glitzernden Schnee. Um Oma Lucy wach zu halten, musste ich sie immer mal wieder schütteln. »Hey, du verpasst die Rentiere. Und den Schnee.« »Diese Sendung ist schrecklich«, sagte sie schließlich. Dass sie ihre Meinung laut ausgesprochen hatte, schien ihr Aufwind zu geben, und sie schlug vor, wir könnten ja vielleicht doch ein paar Geschenke aufmachen. Dickflüssig suppte das Sonnenlicht durch die schweren Vorhänge ins Zimmer, so, als müsste es durch Gaze-Verbände hindurch. Oma Lucy wohnte im dritten Stock einer Wohnanlage, deren rauverputzte Wände die Farbe gebleichter Mandeln hatten. Die meisten ihrer Nachbarn waren Pendler und arbeiteten in New York bei einer Bank. Meine Großmutter liebte Connecticut. Hier hatte sie sich in meinen Großvater verliebt, hier hatten die beiden geheiratet. Er kam eigentlich aus einer alteingesessenen Familie in New England, aber er war es gewesen, der darauf bestanden hatte, nach Westen zu ziehen, um von seiner Familie loszukommen. Dann verabschiedete er sich, um die Welt zu bereisen, und kam nie wieder. Er ließ sie sitzen mit der kleinen gemeinsamen Tochter, die sie ganz allein großziehen musste. Seine Familie sicherte ihr so viel Geld zu, wie sie für den Rest ihres Lebens brauchte. Daraufhin hatte Oma Lucy sich in diese ganze Familie verliebt — das alte Blut, die Traditionen. Meiner Mutter hatte sie ein Gefühl für ihre Herkunft mitgeben wollen, weswegen man den Sommer immer auf Cape Cod verbrachte, in einem Haus der Familie, an das meine Mutter sich nur mit Abscheu erinnerte. »Dieses Strandhaus für zwei armselige Monate im Jahr an uns abzutreten war nichts als schmutzige Bestechung«, sagte sie zu mir. »Da draußen war es mit dem Geld wie mit einem unehelichen Kind — alle wussten darüber Bescheid, aber niemand sprach davon.« Meine Mutter hatte keinerlei Erinnerungen an ihren Vater, aber ihre Wut über ihn war scheinbar groß genug, um das Thema jahrzehntelang eine offene Wunde sein zu lassen. Mit einer Aggressivität, die die Versöhnlichkeit meiner Großmutter wettmachte, entlud sich diese Wut auch gegenüber seiner ganzen Familie. Ohne dass ihr das je hätte gesagt werden müssen, wusste Lucy von Anfang an, dass sie an den verschiedenen Wohnsitzen der Familie nicht willkommen war. Dass es vielleicht besser war, wenn sie drüben an der Westküste blieb. Aber nachdem sie ihre Tochter in Los Angeles aufgezogen hatte, kam sie zurück in die ehrwürdige Menschenleere, in die Kälte des Ostens und den Wohlstand von Greenwich. Sie konnte sich alles kaufen, was sie wollte, aber sie wollte damals nicht viel, weswegen ihre karg eingerichteten Zimmer in ihrer Reinlichkeit geradezu trist wirkten. Meine Mutter sagte: »Sie hat ihm nie vorgeworfen, dass er sie verlassen hat. Das habe ich nie verstanden.« Mit ihren Weihnachtsgeschenken ging Lucy so ordentlich und aufmerksam um wie ein wohlerzogenes Kind. Sie hatte eine Packung mit verschiedenen Schaumbädern und zwei Topflappen von mir bekommen. In die Topflappen war New Yorks bester Auflauf liegt in meinen Händen hineingestickt. Für mich war Oma Lucy schon immer eine gewesen, die Töpfe voller Cremesuppe mit Dosenmais und in dicke Stücke geschnittenen Kalten Hund machte, der salzig wie das Meer und weich wie Seide war. Wenn sie zu uns in den Westen kam, um sich mit um uns zu kümmern, weil meine Mutter bei der Arbeit besonders viel zu tun hatte, kochte sie immer das Abendessen für uns, das meiner Mutter meistens nicht schmeckte. »Diese Eintöpfe sind verkocht bis zum Gehtnichtmehr«, sagte sie. »Ich werde Jahre brauchen, um sie auszuscheißen.« Das hat sie tatsächlich mal so beim Abendessen gesagt. Oma Lucy runzelte nur die Stirn und fing an, den Tisch abzuräumen. Meine Mutter hat immer an den Kochkünsten ihrer Mutter herumgemäkelt — wie sehr sie sich bemühe und wie schlecht sie trotzdem koche. Und wie freudig sie nach Rezepten der Familie koche, die doch nichts mit ihr zu schaffen haben wolle. Als hätte sie nicht ein Fünkchen Stolz im Leib, sagte meine Mutter. Und dazu hat das Zeug auch immer noch grauenvoll geschmeckt. Dann kam der Blaubeerkuchen, dessen Teigkruste abbröselte wie tote Hautfetzen. Da hat sie schließlich aufgegeben und die ganzen alten Familienrezepte einfach weggeworfen, sagte meine Mutter mit Stolz in der Stimme. Sie sagte: »Ich habe in meinem Leben schon viele Kuchen gegessen. Aber so einen schlechten wie diesen noch nicht.« Die Topflappen waren also in gewisser Weise ein um Jahre zu spät kommendes, augenzwinkerndes Siegessymbol. Meine Mutter war auf der anderen Seite des Landes, und Oma Lucy konnte in Ruhe ihre Suppentöpfe, Aufläufe und Kuchen zubereiten. Mit zusammengekniffenen Augen begutachtete sie das Diamant-Stepp-Muster der Lappen. »Ich mache...