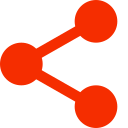E-Book, Deutsch, Band 17, 448 Seiten
Reihe: Manesse Bibliothek
Joyce Dubliner
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-641-22893-4
Verlag: Manesse
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, Band 17, 448 Seiten
Reihe: Manesse Bibliothek
ISBN: 978-3-641-22893-4
Verlag: Manesse
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Nie war er lesbarer: ein Großklassiker der literarischen Moderne - neu übersetzt von Friedhelm Rathjen
Das Augenmerk dieses legendären Klassikers gilt nicht den Lichtgestalten, sondern den Stiefkindern des Glücks - den Sündern und Lügnern, den Bedrückten, Säufern und Schmarotzern. Wie der «Ulysses» lebt auch Joyce' Erstling «Dubliner» von der faszinierenden Atmosphäre seiner Vaterstadt. In fünfzehn Storys schildert der Autor darin das Alltagsleben einfacher Leute. Das Bahnbrechende daran: die nackte Realität wird von ihm weder beschönigt noch diffamiert. Um große Literatur zu schaffen, braucht Joyce keine spektakulären Schicksale. In der Welt der kleinen Leute findet er den Reiz ungeschminkter Wahrheiten und den Stoff, aus dem die wahren Dramen des menschlichen Daseins sind.
James Joyce (1882-1941) gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der literarischen Moderne in Europa. Wenige Autoren haben stärker auf das 20. Jahrhundert eingewirkt als der revolutionäre irische Sprachmagier. Besonders sein Erfindungsreichtum fasziniert: Wie kein Zweiter beherrschte Joyce das Spiel der Wortschöpfungen und poetischen Lautmalereien.
Weitere Infos & Material
Die Schwestern Es gab keine Hoffnung für ihn diesmal: Es war der dritte Schlag. Nacht für Nacht war ich an dem Haus vorbeigegangen (es war Ferienzeit) und hatte das erleuchtete Fensterviereck studiert: Und Nacht für Nacht hatte ich es auf gleiche Weise erleuchtet gefunden, schwach und gleichmäßig. Wenn er tot wäre, dachte ich, würde ich den Widerschein von Kerzen auf dem verdunkelten Rollo sehen, wusste ich doch, dass zu Häupten eines Leichnams zwei Kerzen aufgestellt werden müssen.1 Er hatte oft zu mir gesagt: Ich bin nicht mehr lange von dieser Welt, und ich hatte seine Worte für nichtsnutziges Gerede gehalten. Nun wusste ich, dass sie wahr waren. Jede Nacht, wenn ich zu dem Fenster hochsah, sagte ich leise das Wort Paralyse2 vor mich hin. Es hatte mir immer befremdlich in den Ohren geklungen, so wie das Wort Gnomon im Euklid3 und das Wort Simonie4 im Katechismus. Nun aber klang es mir wie der Name eines böswilligen und sündigen Wesens. Es erfüllte mich mit Furcht, und doch wünschte ich mir, ihm näher zu sein und einen Blick auf sein tödliches Werk zu werfen. Der alte Cotter saß rauchend am Feuer, als ich zum Abendessen runterkam. Während meine Tante mir den Haferbrei einschöpfte, sagte er, als käme er auf eine frühere Bemerkung zurück: – Nein, ich würde nicht sagen, dass er direkt …. aber er hatte was irgendwie Komisches …. hatte was irgendwie Unheimliches an sich. Ich sag Ihnen mal meine Meinung dazu. … Er begann, seine Pfeife zu paffen, zweifellos um sich dabei im Kopf seine Gedanken zurechtzulegen. Langweiliger alter Blödmann! Als wir ihn gerade kennengelernt hatten, war er noch ganz interessant gewesen, wie er so von Vor- und Nachbrand und Schlangen5 daherredete, aber dann ziemlich schnell wurde mir langweilig von ihm und seinen endlosen Geschichten über die Brennerei. – Ich hab so meine eigene Theorie dazu, sagt er. Ich denk, das war einer von diesen … absonderlichen Fällen. … Ist aber schwer zu sagen. … Er begann wieder, seine Pfeife zu paffen, ohne uns seine Theorie auseinanderzusetzen. Mein Onkel bemerkte meinen starren Blick und sagte zu mir: – Also, das wirst du jetzt nicht gern hören, aber dein alter Freund ist nicht mehr. – Wer?, sagte ich. – Pater Flynn. – Ist er tot? – Mr. Cotter hier hat’s uns gerade erzählt. Er ist an dem Haus vorbeigekommen. Ich wusste, dass ich unter Beobachtung stand, drum aß ich einfach weiter, als würde mich die Neuigkeit gar nicht interessieren. Mein Onkel erklärte dem alten Cotter: – Der Bengel und er waren beste Freunde. Der alte Knabe hat ihm eine Menge beigebracht, müssen Sie wissen; und man sagt, er habe einen ziemlichen Narren an ihm gefressen. – Gott sei seiner Seele gnädig, sagte meine Tante fromm. Der alte Cotter betrachtete mich ein Weilchen. Ich spürte, dass mich seine kleinen schwarzen Knopfaugen musterten, aber ich würde ihm nicht den Gefallen tun, von meinem Teller aufzuschauen. Er wandte sich wieder seiner Pfeife zu und spuckte schließlich derb in den Kaminrost. – Ich würde das nicht wollen, sagte er, dass meine Kinder, wenn ich welche hätte, sich zu viel mit so einem abgeben. – Wie meinen Sie das, Mr. Cotter?, fragte meine Tante. – Ich meine einfach, sagte der alte Cotter, das ist schlecht für Kinder. Meine Haltung dazu ist: Soll ein junger Bengel mal lieber losgehen und mit jungen Bengeln in seinem Alter spielen und nicht … Hab ich nicht recht, Jack? – Das ist auch mein Grundsatz, sagte mein Onkel. Soll er mal lernen, sich allein durchzuschlagen. Genau das sag ich auch immer zu diesem Rosenkreuzer6 da: Beweg deine Glieder. Na, als ich so ein Jungspund war, da hab ich jeden einzelnen Morgen kalt gebadet, Winter wie Sommer. Und genau das kommt mir heute zugute. Bildung mag ja schön und gut sein. … Vielleicht mag Mr. Cotter mal einen Bissen von dem Hammelbein nehmen, fügte er an meine Tante gewandt hinzu. – Nein, nein, bloß keine Umstände meinetwegen, sagte der alte Cotter. Meine Tante holte die Platte aus dem Speiseschrank und stellte sie auf den Tisch. – Aber warum meinen Sie, dass das nicht gut für Kinder ist, Mr. Cotter?, fragte sie. – Das ist schlecht für Kinder, sagte der alte Cotter, weil ihr Verstand sich so leicht beeindrucken lässt. Wenn Kinder solche Sachen zu sehen kriegen, wissen Sie, dann tut das seine Wirkung. …. Ich stopfte mir den Mund mit Haferbrei voll vor lauter Angst, meinen Ärger sonst nicht für mich behalten zu können. Langweiliger alter rotnasiger Volltrottel! Es war schon spät, als ich einschlief. Obwohl ich wütend auf den alten Cotter war, weil er mich als kleines Kind hingestellt hatte, zerbrach ich mir doch den Kopf im Bemühen, seinen unvollendeten Sätzen ihren Sinn zu entreißen. Im Dunkel meines Zimmers stellte ich mir vor, ich sähe wieder das schwere graue Gesicht des Paralytikers. Ich zog mir die Decken über den Kopf und versuchte, an Weihnachten zu denken. Das graue Gesicht aber verfolgte mich immer noch. Es murmelte, und ich begriff, dass es etwas zu beichten wünschte. Ich spürte, wie meine Seele sich in eine schöne und üble Region zurückzog, und dort fand ich es wiederum auf mich warten. Es fing an, mir mit Murmelstimme zu beichten, und ich fragte mich, warum es unablässig lächelte und warum die Lippen so feucht von Speichel waren. Dann aber erinnerte ich mich, dass es an Paralyse gestorben war, und ich spürte, dass auch ich selbst schwach lächelte, als wolle ich diesen Simonisten von seiner Sünde lossprechen.7 Am nächsten Morgen ging ich nach dem Frühstück los, um mir das kleine Haus in der Great Britain Street8 anzuschauen. Es war ein bescheidener Laden, der unter der vagen Bezeichnung Tuchwaren lief. Die Tuchwaren bestanden größtenteils aus Kinderstrickstiefeln und Regenschirmen, und an normalen Tagen hing immer ein Schild im Fenster, auf dem stand: Neubespannung von Schirmen. Jetzt war kein Schild zu sehen, weil die Fensterläden vor waren. Ein Trauergesteck war mit einer Kranzschleife am Türklopfer angebracht worden. Zwei arme Frauen und ein Telegrammjunge lasen die Karte, die an dem Gesteck befestigt war. Ich trat ebenfalls davor und las: 1. Juli 1895 Hochw. James Flynn
(früher S. Catherine’s Church, Meath Street) im Alter von fünfundsechzig Jahren. R.?I.?P. Die Lektüre der Karte überzeugte mich davon, dass er tot war, und zu meiner Bestürzung wusste ich nicht weiter. Wäre er nicht tot gewesen, so wäre ich in das kleine dunkle Zimmer hinter dem Laden gegangen und hätte ihn in seinem Sessel am Feuer sitzend vorgefunden, beinahe erstickt von seinem Wintermantel. Womöglich hätte meine Tante mir ein Päckchen High Toast9 für ihn mitgegeben, und dieses Geschenk hätte ihn aus seinem dumpfen Dämmern erweckt. Immer war ich derjenige, der das Päckchen in seine schwarze Schnupftabaksdose entleerte, denn seine Hände zitterten zu sehr, als dass ihm dies möglich gewesen wäre, ohne den halben Tabak auf dem Fußboden zu verschütten. Schon wenn er sich seine große zittrige Hand an die Nase hob, rieselten ihm kleine Wolken durch die Finger vorne auf den Mantel. Vielleicht waren es diese ständigen Tabakschauer, die seinen altehrwürdigen Priestergewändern ihr grünes verschossenes Aussehen verliehen, dann das rote, stets von den Schnupfflecken einer Woche geschwärzte Taschentuch, mit dem er die herabgefallenen Krümel wegzuwischen versuchte, war ziemlich wirkungslos. Ich wäre gern reingegangen und hätte ihn mir angesehen, aber mir fehlte der Mut, zu klopfen. Ich ging langsam auf der besonnten Straßenseite davon und las im Gehen all die Theateranzeigen in den Schaufenstern. Ich fand es befremdlich, dass weder ich noch der Tag in Trauerstimmung schien, und ich verspürte sogar Verärgerung, als ich in mir ein Gefühl von Freiheit bemerkte, als wäre ich durch seinen Tod von etwas befreit worden. Das verwunderte mich, denn wie durch meinen Onkel letzte Nacht erwähnt worden war, hatte er mir eine ganze Menge beigebracht. Er hatte am Irischen Kolleg in Rom10 studiert und mir beigebracht, wie man das Lateinische richtig ausspricht. Er hatte mir Geschichten über die Katakomben11 und über Napoleon Bonaparte12 erzählt, und er hatte mir die Bedeutung der unterschiedlichen Zeremonien der Messe und der unterschiedlichen vom Priester getragenen Gewänder erklärt. Gelegentlich hatte er sich den Spaß gemacht, mir knifflige Fragen zu stellen; hatte etwa von mir wissen wollen, was man unter bestimmten Umständen zu tun habe oder ob diese oder jene Sünden Todsünden oder lässliche Sünden oder bloß Unvollkommenheiten wären. Seine Fragen zeigten mir, wie kompliziert und geheimnisvoll bestimmte Regularien der Kirche waren, die ich immer für einfachste Abläufe gehalten hatte. Die Pflichten des Priesters gegenüber der Eucharistie13 und gegenüber dem Beichtgeheimnis kamen mir so schwerwiegend vor, dass ich mich fragte, wie wohl irgendwer jemals den Mut hatte aufbringen können, sie auf sich zu nehmen: und ich war nicht überrascht, als er mir erzählte, die Kirchenväter hätten Bücher geschrieben, so dick wie das Postadressbuch und so kleingedruckt wie die...