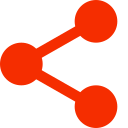E-Book, Deutsch, 208 Seiten
Keller Blauer Sand
1. Auflage 2024
ISBN: 978-3-03855-284-0
Verlag: Limmat Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Roman
E-Book, Deutsch, 208 Seiten
ISBN: 978-3-03855-284-0
Verlag: Limmat Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Seit siebzehn Jahren versteckt sich Leo auf der Sandinsel in der Flensburger Förde. Nur im Oktober verlässt er sie, um seinen jährlichen Mord zu begehen. Er tötet Menschen, die der Welt Schaden zufügen und vom Elend anderer profitieren wie der Katastrophenkapitalist A. J. Hicks.?Als Leo von seinem jüngsten Mord auf die Sandinsel zurückkehrt, erwartet ihn Thea. Sie ist die Tochter seines vierzehnten Mordopfers, eines Mannes, der einst dafür sorgte, dass der seltene blaue Sand von der Insel verschwand. Thea ist fest entschlossen, ihren Vater zu rächen. Doch je mehr sie in den Sog der magischen Sandinsel gerät, umso mehr kommt ihr Plan ins Wanken.?Poetisch und mit viel Witz erzählt Christoph Keller von zwei Menschen, die angesichts der Klimakatastrophe Ungerechtigkeiten radikal bekämpfen und sich dabei ständig fragen: Muss man nicht töten, wer der Welt so viel Leid zufügt?
Christoph Keller, geboren 1963, ist der Autor zahlreicher preisgekrönter Romane, unter anderem «Der beste Tänzer», «Der Boden unter den Füssen» und «Jeder Krüppel ein Superheld», sowie Herausgeber der Anthologie «Und dann klingelst du bei mir. Geschichten in Leichter Sprache» (2023). Keller, der über zwanzig Jahre in New York gelebt hat und mit der amerikanischen Lyrikerin Jan Heller Levi verheiratet ist, schreibt auf Deutsch und Englisch. Er lebt in St.?Gallen.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
ANKUNFT
Die Sandinsel ist die zweite und größte der vier Inseln, die den Fast-beim-Festland-Archipel bilden. Die kleinste heißt Ochseninsel, darauf befinde ich mich. Die Überfahrt auf die Sandinsel, die nur über die Ochseninsel zu erreichen ist, dauert achtzehn Minuten. Der Kutter fasst zweiundzwanzig Passagiere und fährt erst los, wenn diese Zahl erreicht ist und sich jemand bereit erklärt, das Steuer zu übernehmen. Die Fährfrau macht Liv schon lange nicht mehr. Auf dem Kutter steht in ungelenken Buchstaben «Krake», was aber noch niemanden davon abgehalten hat, überzusetzen. Kaum jemand, der sich hier einfindet, dürfte wissen, dass ein Krake ein achtarmiger Tintenfisch mit drei Herzen ist, ein mit Saugnäpfen ausgestatteter Kopffüßler, dessen mythische Version mit sich in die Tiefe zieht, worauf sie Lust hat. Ich weiß es, ich habe mich auf diese Reise vorbereitet. Aber ich werde mich von keinem Kraken in die Tiefe ziehen lassen. Ich bin der Krake. Wer auf die beiden anderen Inseln – die Seeräubermöweninsel und Juan-Fernández – will, muss sich seine Überfahrt vom Festland her selbst organisieren oder für das dänische Nationalparkprogramm arbeiten, zu dem der Archipel seit einigen Jahren gehört. Liv sagt, die Parkleute ließen sich nie auf ihrer Insel blicken. Ihre Bude dürfte eigentlich nicht in einem Nationalpark stehen, man habe aber ein Auge zugedrückt, weil sie schon da war, bevor es dem Nationalparkprogramm einfiel, sich die Inseln einzuverleiben. Auch, weil ihre Bude von nationaler Bedeutung sei. Auflage: Nichts dürfe angebaut, nichts verändert werden, nach Liv sei dann auch die Bude zu. Das ist ihr recht. Was sich auf den anderen Inseln ereignet, bekommt sie auf der Ochseninsel nicht mit. Der Fast-beim-Festland-Archipel, «Nærfastlandsøhavet» auf Dänisch, ist das Stiefkind der dem Umweltministerium unterstellten Naturbehörde. Vieles von dem, was mir Liv erzählt, weiß ich bereits. Wenn sie abrupt schweigt, als wolle sie die nächsten Wörter nicht aus dem Mund fallen lassen, könnte ich ihren Satz weiterführen. Ich tue es nicht, es würde sie verletzen. Die Inseln hüpfen vom Festland in die Flensburger Förde wie ein flach geworfener Stein. Von weit oben betrachtet könnte man sie für eine kleine Entenkarawane halten. Für mich sind sie Wolken. Ein neuer Vulkan ist aufgebrochen … Meine Insel scheint eine Art Wolkenhalde zu sein. Alle übrig gebliebenen Wolken der Hemisphäre sind eingetroffen und hängen über den Kratern – Diese Zeilen habe ich vor meiner Abreise in mein Notizbuch, in dem ich Gedichte sammle, eingetragen und bin jetzt überrascht, wie treffend sie sind. Papa, dem die Zivilisation immer weniger zu bieten hatte und der mir schon früh beigebracht hat, unsinnige Regeln – seiner Meinung nach also die meisten – zu ignorieren, nahm mich manchmal auf eine seiner abenteuerlichen Reisen mit. Diese waren oft auf kleine Passagierflugzeuge mit spritfressenden Motoren angewiesen, und da hockte ich dann erstarrt und fasziniert, die Hände um die Knie geschlungen, in einem laut scheppernden geflügelten Vehikel. Aus Hunderten von Metern Höhe schaute ich sehnsüchtig auf das Blau des Wassers hinunter, aus dem die Inseln magisch auftauchten. Wolken, alle waren sie für mich Wolken! Immer wieder bat ich Papa, mit seinem Flugzeug kopfüber zu fliegen. Manchmal tat er es, und schon waren die Inseln wirklich Wolken. Von oben habe ich die Inseln in ihrer wahren Gestalt gesehen. Die eine ist eine Kaulquappe, eine andere eine Schlange. Eine, Rapa Iti zum Beispiel, die zu Französisch-Polynesien gehört, ist ein Seepferd, die da eine Kröte, die gleich weiterhüpfen wird. Ich habe eine gesehen, die wie ein Fußabdruck daherkommt, ich kenne eine herz- und eine sichelförmige und eine – drei eigentlich (die malaysischen Inseln Manukan, Mamutik und Sulug) –, die das Smile-Emoji vorausgeahnt haben. Ich weiß um die Schönheiten der Inseln – wer nicht? –, aber auch um ihre Gefahren, vor denen sie uns so deutlich und so vergeblich warnen. Klippen schroff und steil wie die Schwarzbruderklippe der Sandinsel, Strudel, die ein wackeres Schiff mit der Gier eines Kraken versenken, Inseln, die sich zur Abschreckung ihr eigenes Klima geschaffen haben oder ein Nebelmeer bilden, in dem sie untertauchen. Die Sandinsel hat es mit blauen Sandstränden versucht und damit das Gegenteil erreicht, weil sie mit ihrem Wunder zu viele angelockt hat. Die Ochseninsel misst nullkommaacht Quadratkilometer, ist zwei Kilometer lang und achthundert Meter breit. Der Mittelstreifen ist von einem lockeren Fichtenwald bewachsen, die Längsufer sind felsig und als Strände ungeeignet. Die Insel ist flach – an der höchsten Stelle zwölf Meter über Meer – und liegt so nah am Festland, dass man zu ihr hin waten könnte. Das ist aber nicht nötig, denn es gibt eine schmale Holzbrücke, die von Wanderern, Radfahrern und immer wieder Rudeln von Bikern benutzt wird. Das Parkplatzproblem lösen diese, indem sie ihre kolossalen Motorräder zwischen den Bäumen parken, sodass sich zu Hochbetriebszeiten mehr Räder als Bäume auf der Insel befinden. So wird der Fichtenwald zum Räderwald, der im Licht dunkel funkelt, ein verwundetes Tier, das losröhrt, sobald ein Gast auftaucht. Liv ist überzeugt, dass es deshalb auf der Ochseninsel keine Vögel mehr gibt. (Ochsen gab es hier nie.) Schon lange hat sie kein Zwitschern mehr gehört. Sie vermisst es. Aber noch mehr würde sie ihre Bude vermissen, die auf die Biker angewiesen ist. An Tag eins meiner Anwesenheit besuchte sie mich dreimal in meinem Zimmer. Der Aschenbecher, den ich sie zu entfernen bat, glitt ihr aus der Hand. Sie stolperte ohne Anlass und konnte sich gerade noch aufs Bett werfen. Als sie meinen Namen sagen wollte, brachte sie nur ein Schlucken zustande. Manchmal lacht sie laut heraus, auch wenn es nichts zu lachen gibt. Ich mag ihr Lachen. Mich verwundert, wie viel, ruhig und traumlos ich hier schlafe. Etwas hat Liv klar gemacht, dass ich an meinem zweiten Tag in ihrer Bude nicht gestört werden wollte. Durch die dünnen Wände hörte ich ihre Schritte, bis mir die Vertrautheit, die sich einzustellen begann, gespenstisch wurde und ich mir die Ohren mit Watte zustopfte. Tag drei, also heute, benutze ich, um mein Vorhaben Stufe für Stufe mit geschlossenen Augen zu visualisieren, wieder und wieder lasse ich die Bilder im Kopf ablaufen. Ich rufe meine Schwester von einem Wegwerfhandy an, das ich gleich danach zerstöre, und sage ihr, es sei alles in Ordnung, was es nicht ist. Ich lese in meinem Gedicht-Notizbuch: Schaut, wie ich sitze wie ein an Land gezogener Kahn. Hier bin ich glücklich. Ich schlendere zum Steg hinunter, schaue von der Ochseninsel aus zu, wie die Sandinsel ihren Anker lichtet und in die Dämmerung davontreibt. Ein paar sesshafte Tage tun mir gut. Meine Hände sind ruhig, mein Herz ist es auch. Sogar meine Gedanken wirbeln weniger durcheinander. Ich bin schon lange unterwegs, zu nomadisch selbst für meine Verhältnisse. Mit dem Schiff, der Eisenbahn, dem Rad, zu Fuß. Nirgendwo bleibe ich länger als einen Tag, höchstens zwei. Ich will von nichts eingeholt werden. Dabei habe ich, was ich auf meinem Körper tragen kann, meinen purpurnen Rucksack und die Kreditkarte, die mir Papa einst gegen meinen Willen auf meinen Namen ausgestellt hat. Ich benutze sie, man kann mich also aufspüren. Noch sucht man mich nicht. Erst wenn ich mein Vorhaben ausgeführt habe, werde ich die Kreditkarte zusammen mit meinem Reisepass und den anderen mich identifizierenden Dokumenten entsorgen. Ich werde verbrennen, was brennbar ist, zertrampeln, was meine Schuhsohlen vermögen. Die Chips, den Plastik und was von meinem Handy unzerstörbar ist, werde ich in die Strahlenschutzhülle packen, die ich zu diesem Zweck dabeihabe und durch die sich auch die gefräßigsten Fische nicht beißen können. Dann werde ich alles in der Förde versenken. Die letzte Strecke meiner Reise bin ich auf einem Fahrrad gekommen, das ich in Flensburg gemietet habe. Über Feldwege bin ich geradelt, entlang dem Wasser, unter Bäumen hindurch, am wild blühenden Raps vorbei. Einmal gab ich dem Drang, gelb zu werden, nach. Ich warf das Rad an den Wegrand und rannte durch das Rapsfeld. Ich fuhr mit den Händen in die Luft, sang aus voller Kehle. Ich zog am Wasser vorbei, an mir zogen Kähne vorbei. Von Süderhaff waren es noch fünf Minuten bis zur Brücke, die mich auf die Ochseninsel brachte. Autos sind auf der Ochseninsel nicht geduldet. Wer es dennoch wagt, in einem über die Brücke, die dafür nicht gebaut ist, auf die Insel vorzudringen, wird mit Schrot verjagt. Dieses Verbot gilt auch für die einzige Bewohnerin der Insel. Liv zieht alles, was sie braucht, wie ein Maultier auf einem Schlitten zu ihrer Bude. Es würde auch einfacher gehen, doch sie braucht dieses Bild von sich, die schleppende, von nichts und niemandem abhängige Frau. Mir sagt ein weniger machohafter Feminismus mehr zu. Auf die Brücke, die Jens, ihr Budenpartner, kurz vor seinem Ableben «Livs Brücke» getauft hat, folgt ein ausgetretener Fußpfad, der sich durch den zerzausten Fichtenwald schlängelt und hinter Livs Bude endet. Für die eingeweihten Biker ist es Ehrensache, bei der Anreise in der rechten, bei der Abreise in der linken von Livs tiefen Kufenspuren zu fahren. «Bude» ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für das, was Liv aufgebaut und ein Vierteljahrhundert lang über Wasser gehalten hat. ...