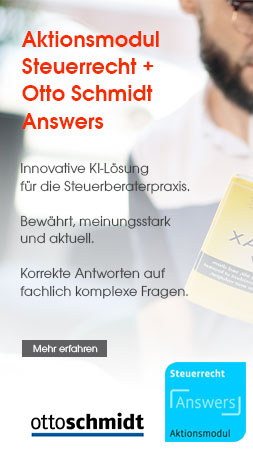E-Book, Deutsch, 398 Seiten, E-Book
Reihe: Haufe Fachbuch
Lüdenbach IFRS - inkl. Arbeitshilfen online
8. Auflage 2016
ISBN: 978-3-648-08033-7
Verlag: Haufe
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Training für Ausbildung und Praxis
E-Book, Deutsch, 398 Seiten, E-Book
Reihe: Haufe Fachbuch
ISBN: 978-3-648-08033-7
Verlag: Haufe
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
"Lüdenbach, IFRS" - das Standardwerk zum Thema!
Ausgehend vom HGB führt der Autor anschaulich und leicht verständlich in die IFRS-Rechnungslegung ein. Schritt für Schritt werden die Inhalte sämtlicher IFRS und IFRIC erläutert. Alle Beispiele beruhen auf der breiten Beratungs- und Gutachtererfahrung von Dr. Norbert Lüdenbach. Ein Buch für alle Fach- und Führungskräfte im Rechnungswesen, innovative Unternehmen und deren Berater.
Inhalte:
- Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9
- Konsolidierung nach IFRS 10 bis IFRS 12
- Fair-value-Bewertung nach IFRS 13
- Leasingbilanzierung nach IFRS 16
- Umsatzrealisierung nach IFRS 15
Besonders hilfreich:
- Zahlreiche Praxisbeispiele mit detaillierten Anwendungshinweisen
- Über 150 Prüfschemata
- Checklisten und Schaubilder
- 111 Aufgaben und Lösungen für Studierende
Arbeitshilfen online:
- E-Training und Online-Selbsttests
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Rechtswissenschaften Steuerrecht Bilanz- und Bilanzsteuerrecht, Rechnungslegung, Betriebliches Steuerwesen
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Externes Rechnungswesen, Rechnungslegung, Bilanzierung
- Rechtswissenschaften Steuerrecht Internationales und Europäisches Steuer-, Bilanz- und Rechnungslegungsrecht
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Internationales Rechnungswesen
Weitere Infos & Material
Vorwort zur 8. Auflage
Zuordnung der Standards zu den Kapiteln
Abkürzungsverzeichnis
Perspektiven einer Internationalisierung der Rechnungslegung
- Der gesetzliche Rahmen
- Erfolgspotenziale im Unternehmen
- Das Nebeneinander von handelsrechtlichem Einzelabschluss und IFRS-Konzernabschluss
- Zukunftsperspektiven ? Freigabe der IFRS für den Einzelabschluss?
- Die SME-IFRS
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Struktur und Grundannahmen des IFRS-Regelwerks
- Organisation des IASB
- EU-Endorsementverfahren
- Aufbau des IFRS-Regelwerks
- : Konzeptionelle Grundlagen des IFRS-Abschlusses
- IAS 1: Ausweis- und Gliederungsvorschriften
- -Grundsatz
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Immaterielles und Sachanlagevermögen sowie
- Ausweis und Untergliederung
- Bilanzansatz
- Zugangsbewertung zu Anschaffungs-/Herstellungskosten
- Planmäßige Abschreibung
- Außerplanmäßige Abschreibung
- Wertaufholung und Neubewertung
- Sonderfälle
- , insbesondere Anlagenspiegel
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Finanzvermögen
- Überblick
- Bilanzansatz: Zurechnung von Finanzaktiva bei Factoring und vergleichbaren Fällen
- Bewertung und Erfolgserfassung nach dem Klassifizierungssystem von IFRS 9
- Einzelfälle der Bewertung
- Finanzderivate und
- , inkl. Beziehungen zu nahestehenden Parteien
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Vorräte
- Überblick
- Engerer Begriff der (un-)fertigen Erzeugnisse und Leistungen
- Ansatz von Vorräten
- Bewertung von Vorräten
- Ausweis und
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Eigenkapital
- Ausweis und Abgrenzung
- Sacheinlagen, einschließlich debt-for-equity-swaps
- ? Mitarbeiteroptionen
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Rückstellungen
- Ausweis
- Bilanzansatz
- Bewertung
- Sonderfall: Pensionsrückstellungen und sonstige Arbeitnehmerrückstellungen
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Verbindlichkeiten
- Ausweis
- Bewertung
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Tatsächliche und latente Steuern
- Überblick und Vergleich zum Handelsrecht
- Der Zweck latenter Steuern nach dem -Konzept
- Ausweis
- Ansatz
- Bewertung
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Gewinn- und Verlustrechnung
- Ausweisvorschriften
- Erlösrealisierung
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Weitere Abschlussbestandteile
- Eigenkapitalveränderungsrechnung (im Verhältnis zur Gesamtergebnisrechnung)
- Kapitalflussrechnung
- Notes ? Aufbau und Funktion des Anhangs
- Besondere Berichtspflichten für kapitalmarktorientierte Unternehmen
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Konzernabschluss
- Überblick
- Aufstellungspflicht und Konsolidierungskreis
- Abschlussstichtag und Erstkonsolidierungszeitpunkt
- Kapitalkonsolidierung
- Weitere Vorschriften
- Latente Steuern im Konzernabschluss
- -Methode für assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
Einführung von IFRS
- Einführungsplanung
- Umstrukturierung der Finanzbuchhaltung
- Eröffnungsbilanz nach IFRS 1
- Zusammenfassung
- Aufgaben und Lösungen
IFRS für kleine und mittlere Unternehmen
- Die SME-IFRS
- Aufgaben und Lösungen
Checkliste wesentlicher Abweichungen der IFRS vom HGB
Literaturempfehlungen
Stichwortverzeichnis
1 Perspektiven einer Internationalisierung der Rechnungslegung
1.1 Der gesetzliche Rahmen
Wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der neue Marketing- oder Managementphilosophien im Allgemeinen in die Unternehmenspraxis eindringen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die diesbezüglichen Unternehmensstrategien zuweilen eher von einem olympischen als von einem ökonomischen Geist beseelt sind: dabei sein ist alles und die Teilnahme wichtiger als der Sieg.
Das Finanz- und Rechnungswesen scheint weniger modeanfällig, ist es doch nach Personen und Zielsetzungen durch einen durchaus gesunden Konservativismus geprägt. So vergingen seit der Gründung des International Accounting Standards Committee (IASC) in 1973 über 30 Jahre, bis die internationale Rechnungslegung Eingang in die europäische und deutsche Bilanzierungspraxis fand.
Das europäische und deutsche Bilanzrecht hatte der Globalisierung auf den Güter- und Kapitalmärkten zuvor kaum Rechnung getragen.
Beispiel
Ein Lampenhersteller, der in irgendeinem deutschen Landstrich Lampen herstellt, die er in ganz Europa vertreibt, kann sich daran freuen, dass es einen Eurostecker gibt und er somit nicht für jedes Land andere Stecker an seinen Lampen anbringen muss. Der gleiche Lampenhersteller musste aber, wenn er Produktions- und Vertriebsgesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern unterhielt, in jedem Land nach einem anderen System Rechnung legen.
Dies galt/gilt selbst innerhalb der europäischen Gemeinschaft. Die EU-Richtlinien der 80er Jahre, umgesetzt durch das BiRiliG 1987, ebenso die EU-Richtlinie aus 2013 und ihre Umsetzung durch das BilRUG, haben keine wirkliche Vereinheitlichung der europäischen Rechnungslegung gebracht. Standardisiert wurde nur die Veröffentlichungs- und Prüfungspflicht für Kapitalgesellschaften. Der zu publizierende und zu prüfende Inhalt, also die Regeln, nach denen diese Gesellschaften Rechnung legen, wurden hingegen kaum vereinheitlicht.
Beispiel
Ein englisches Grundstück aus der Nachkriegszeit, Verkehrswert 1 Mio. EUR, steht bisher mit 10.000 EUR in den englischen Büchern. Der Buchungssatz „Grundstück an Eigenkapital 990.000 wegen Neubewertung” befremdet jeden deutschen Buchhalter.
Die EU-Bilanzrichtlinien haben solche Unterschiede eher zementiert. Unterschiedliche Bilanztraditionen wurden nicht durch Einigung, sondern durch Ausklammerung erledigt. Das Instrument hierzu war das Mitgliedstaatenwahlrecht, das im Beispiel den Engländern die Neubewertung zugestand.
Ein Informationskostenproblem ergab sich hieraus nicht nur für den international agierenden Mittelständler, sondern auch für seine Bank. Deren Branchenexperten für bestimmte Industrien sitzen z. T. längst in London. Wenn also im Beispiel der Lampenhersteller eine grundlegende Neustrukturierung seiner Finanzierung braucht, werden vielleicht Bankexperten aus London einfliegen und das Unternehmen, seine Bilanzen und seine darauf fußenden Businesspläne untersuchen. Unwahrscheinlich, dass sie etwas vom HGB verstehen.
Im Interesse der Effizienz der konzerninternen Kommunikation, ebenso aber mit Blick auf international agierende externe Abschlussadressaten haben daher in den 90er Jahren die großen börsennotierten Unternehmen ihre Konzernabschlüsse internationalen Bilanzierungsregeln angepasst.
Die rechtliche Möglichkeit hierzu eröffnete das KapAEG aus 1998 mit der Einführung eines § 292a in das Handelsgesetzbuch. Dies erlaubte Konzernen, deren Wertpapiere (Aktien und/oder Schuldverschreibungen) an einer Börse notieren, den Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen aufzustellen.
Die EU-Verordnung vom 27. Mai 2002, betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards für kapitalmarktnotierte Konzerne tat ein Weiteres. Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind seit 2005 verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach IFRS zu erstellen. Die Verpflichtung gilt „nur” für Unternehmen, deren Wertpapiere an einem organisierten Markt notiert sind, daher z. B. nicht für in sog. Entry Standards (Freiverkehr) notierte Unternehmen.
Die EU-Verordnung ist unmittelbares, in allen Mitgliedstaaten geltendes Recht. Den Mitgliedstaaten wird im Rahmen eines Mitgliedstaatenwahlrechtes noch die Möglichkeit gegeben, die Anwendung der IFRS auch auf Konzernabschlüsse nichtbörsennotierter Unternehmen und auf Einzelabschlüsse auszudehnen.
Die Bundesrepublik hat diese Mitgliedstaatenwahlrechte wie folgt ausgeübt: Nur das erste Wahlrecht hat der deutsche Gesetzgeber konsequent umgesetzt. Nach § 315a Abs. 3 HGB können nicht kapitalmarktorientierte Konzerne wahlweise an Stelle des handelsrechtlichen (d. h. in Befreiung von diesem) einen IFRS-Konzernabschluss aufstellen und veröffentlichen. Für diese nichtbörsennotierten Unternehmen stellt sich daher weiterhin die Frage,
-
ob und wann eine Anpassung an internationale Rechnungslegungsgrundsätze erfolgen soll,
-
in welcher Form die Anpassung vorgenommen werden soll, ob als Ersetzung des HGB-Abschlusses durch einen internationalen Abschluss oder in einer parallelen Form, d. h. als Überleitungsrechnung oder als doppelter Abschluss.
1.2 Erfolgspotenziale im Unternehmen
Im Wesentlichen kommen fünf Argumente für eine Internationalisierung infrage:
-
besserer Zugang zum Kapitalmarkt,
-
Orientierung an (Informations-)Bedürfnissen der shareholder,
-
Imagevorteile,
-
Abstimmung von externem und internem Rechnungswesen,
-
Vereinheitlichung des internen Konzernreportings.
Am wichtigsten sind der erste und der letzte Punkt.
Die Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten muss nicht nur das Unternehmen betreffen, das ein Listing an einer Börse anstrebt und ab Zulassungsantrag ohnehin zur Rechnungslegung nach IFRS verpflichtet ist (§ 315a Abs. 2 HGB). Auch folgender Fall ist einschlägig:
Beispiel
Ein mittelständischer Industriekonzern strebt die Übernahme eines englischen Wettbewerbers an. Der hohe Finanzierungsbedarf soll durch einen Konsortialkredit der beiden Hausbanken gedeckt werden. Diese möchten Teile des Kredits im Innenverhältnis an andere, von London aus agierende Banken weiterreichen. Gegenüber einem deutschen Konzernabschluss haben die potenziellen internationalen Partner der Banken teils aus sprachlichen, teils aus möglicherweise unberechtigten, aber jedenfalls vorhandenen inhaltlichen Gründen eine starke Aversion. Eine Refinanzierung der Hausbanken und damit die Finanzierung des Unternehmens hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn Plan- und Istzahlen nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt werden. Diese Anforderung wird daher zum Bestandteil des Kreditvertrags.
Wichtiger als derartige externe Vorteile können interne Effekte aus der Vereinheitlichung des Konzernreportings sein. Auch mittelständische Unternehmen sind auf vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen immer häufiger an ausländischen Tochterunternehmen beteiligt. Nicht selten ist dabei zu beobachten: Fehlentwicklungen ausländischer Töchter werden erheblich später erkannt als vergleichbar bei deutschen Tochterunternehmen. Entsprechend verspätet fallen auch die notwendigen Anpassungsentscheidungen aus, vom Austausch des Country-Managers über eine Restrukturierung der Tochtergesellschaft bis zur ihrer Liquidation. Entsprechend höher sind die Kosten solcher Anpassungsentscheidungen. Eine wichtige Ursache derartiger Fehlsteuerung ist der Verzicht auf ein aussagefähiges, zeitnahes unterjähriges Konzernreporting. Jede ausländische Tochter berichtet nach ihrem nationalen Rechnungslegungssystem oder nach ihrem höchst lückenhaften HGB-Verständnis. Die inländische Zentrale eines mittelständischen Konzerns ist jedoch personell nicht so ausgestattet, dass sie jeweils die „Übersetzung” in das Berichtsformat der Muttergesellschaft vornehmen könnte. Fehlentwicklungen werden nicht richtig und nicht rechtzeitig interpretiert. Ihre zu späte Beseitigung kostet ein Vielfaches mehr, als die frühzeitige Einführung eines einheitlichen, an internationalen Grundsätzen orientierten Konzernreportings je hätte kosten können.
1.3 Das Nebeneinander von handelsrechtlichem Einzelabschluss und IFRS-Konzernabschluss
Der deutsche Gesetzgeber hat das Mitgliedstaatenwahlrecht zur Freigabe der IFRS für den Einzelabschluss nicht an die Unternehmen weitergegeben. Auf mittlere Frist werden daher sowohl die börsennotierten Konzerne, die zwangsweise nach IFRS Rechnung legen müssen, als auch die sonstigen Konzerne, die ihren Konzernabschluss freiwillig nach IFRS aufstellen, doppelgleisig fahren müssen:
-
Einzelabschluss nach HGB,
-
Konzernabschluss nach IFRS.
Ein erstes Problem dieser Zweigleisigkeit sind mögliche Irritationen bei den Bilanzadressaten:
Beispiel
Der XYZ-Konzern besteht aus der großen Muttergesellschaft X und den kleinen Tochtergesellschaften Y und Z. Die Tochtergesellschaften tragen gemeinsam nur zu weniger als 10 % zum Konzernergebnis bei. Der handelsrechtliche Einzelabschluss der X weist dennoch...