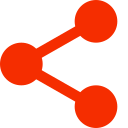E-Book, Deutsch, 256 Seiten
O'Connor Erinnerungen
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-96775-063-8
Verlag: riva
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Rememberings. Deutsche Ausgabe. New-York-Times-Bestseller.
E-Book, Deutsch, 256 Seiten
ISBN: 978-3-96775-063-8
Verlag: riva
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Sinéad O?Connor ist zurück: schmerzvolle Kindheit, gigantischer Welthit, ergreifende Niederlagen und Siege - die schonungslos offene Autobiografie Sie ist die Frau mit dem kahl rasierten Kopf, die »Nothing Compares 2 U« zu einem weltweiten Hit machte, vor laufenden Kameras ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerriss und zur meistgehassten Person wurde. Sinéad O?Connor hat immer das gemacht, was sie für richtig hielt - egal, ob ihr das Nachteile brachte oder nicht. Auch in ihren Erinnerungen nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Spricht über ihre schmerzhafte Kindheit, musikalische Erfolge und persönliche Niederlagen. Aber auch über das Glück, Mutter zu sein, ihre fortwährende Suche nach spiritueller Erfüllung - und die Kraft der Musik, mit deren Hilfe sie überlebte und zu sich selbst fand.
Sinéad O?Connor, geboren 1966 in Dublin, war eine der weltweit erfolgreichsten Musikkünstlerinnen und Songwriterinnen. 1990 stürmte sie mit ihrer Interpretation des Prince-Songs »Nothing Compares 2 U« die weltweiten Hitlisten. Seitdem verkaufte sie mehr als 7,7 Millionen Tonträger. Ihre zehn Studioalben wurden mit zahlreichen Platin und Goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Bis zu ihrem Tod 2023 lebte die Sängerin in Irland. N/A
Weitere Infos & Material
Lourdes
Wir sind gerade von Lourdes zurückgekommen, vor fünf Tagen. Bisschen dramatisch. Sagen wir einfach, es gab eine »Episode« seitens meiner Mutter, nach der ein Priester von mir beschwatzt und an seinem Arm herbeigezerrt wurde, um ihr zu helfen, denn wegen nichts anderem sind wir hingefahren. Na ja, ich bin deswegen hingefahren; die anderen mussten mitkommen, weil der Ausflug das Konfirmationsgeschenk war, um das ich gebeten hatte. Jesus’ Mutter, so mein Deal, möge doch mal sehen, ob sie meiner helfen könne. Ich sagte niemandem, dass ich so etwas dachte. Sie schoben es einfach darauf, dass ich von der ganzen Lourdes-Sache besessen war, weil ich seit Jahren darüber gelesen hatte. Meine Oma hat mir davon erzählt, wegen meines Geburtstags und weil mein zweiter Vorname, Bernadette, auch der Name des jungen Mädchens war, das dort die Jungfrau Maria gesehen hatte. Am Tag vor unserer Rückkehr von Lourdes nach Dublin hatte sich immer noch keine Heilung für den Wahn meiner Mutter gefunden, also beschloss ich gegen vier Uhr nachmittags, auf Priesterfang zu gehen. Mein auserwähltes Opfer wurde unter (meinem) Protest an seinem Ärmel mitgeschleift und war nicht so erpicht darauf, sich ans Werk zu machen, wie ich das von ihm erwartete. Er bummelte mit seiner Zeitung durch den Sonnenschein an der Pforte der Basilika vorbei. Schließlich gab er klein bei, weil ich ihm zu viel war (ich präsentierte die Kulleraugen); er glotzte mich an, als wäre ich verrückt, zu glauben, in Lourdes könnten Wunder geschehen, obwohl seine Chefs ihn angeheuert hatten, genau das zu verkaufen. Ich hatte meiner Mutter gesagt, dass ich mir ein Eis holen wolle, deshalb erzählte ich ihm, während ich ihn die Straße hinaufschob – eine Hand auf seinem Rücken, die andere noch immer an seinem Ärmel, damit er nicht entkommen konnte –, die Bullshit-Geschichte darüber, wie wir uns getroffen hatten, in der Hoffnung, dass er sie besser verkaufen würde als die Lourdes- Geschichte. Er geht also rauf in ihr Zimmer. Ich sitze in der kleinen Hotellobby und beobachte die hübschen französischen Damen, die sich richtig anstrengen, nicht hübsch auszusehen, weil sie ja schließlich in Lourdes sind. Nach einer Weile kommt er wieder hinunter, seine Zeitung unterm Arm, seinen cowboyartigen schwarzen Hut auf dem Kopf, der Blick aus seinen grünen Augen feucht und auf den Boden geheftet. Als er an meinem Stuhl vorbeifegt, gibt er mir mit dem Kopf ein Zeichen, ihm nach draußen zu folgen. »Ich kann nichts für sie tun«, sagt er, und dass ich beten solle, bis ich achtzehn sei und dann von Zuhause weggehen könne, es sei denn, es sei mir möglich, früher zu gehen. Na wunderbar, denke ich. Ein Priester ohne Hoffnung. Wie zur Hölle ist der denn gerade hier gelandet? Ein paar Jahre zuvor hatte ich nämlich selbst so ein Lourdes-Wunder erlebt. Ich hatte eine Dornwarze, eine Fußsohlenwarze, links, neben dem kleinen Zeh. Ein großes schmerzhaftes Ding mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Es war wie das Mädchen in diesem alten Folksong, das Anachie Gordon liebt – ihr Herz wollte auch nicht klein beigeben. Ich hatte also einen Termin im Krankenhaus, um die Dornwarze operativ entfernen zu lassen. Eine glorreiche Angelegenheit, denn das bedeutete, dass man mich mindestens zwei Tage lang bis zum Gehtnichtmehr verwöhnen und mit einer Tonne Mitgefühl überschütten würde; jeder würde ausgesprochen nett zu mir sein müssen und natürlich würde ich auch ein paar schöne schulfreie Tage haben, und im Krankenhaus würde es Eis und Wackelpudding geben. In der Nacht vor meiner Aufnahme ging meine Mutter mit mir ins Badezimmer und gab etwas Weihwasser aus Lourdes auf meine Dornwarze, das ihr meine Oma Jahre zuvor gegeben hatte. Am Morgen war die Dornwarze weg. Vollständig verschwunden. Niemand hätte je geahnt, dass sie einmal da gewesen wäre; es gab keine Spur mehr von ihr. Also weiß ich, dass es Lourdes-Wunder gibt – anders als mein Freund, der Priester. Wir waren über ein Reisebüro nach Lourdes gekommen. Am Flughafen holte uns ein Reisebus ab. Wir fuhren zusammen mit etwa zwanzig anderen Leuten, die dieselbe Tour gebucht hatten. Es ging nicht nur nach Lourdes; zuerst besuchten wir eine Stadt namens Nevers, um das Kloster zu sehen, in dem die Heilige Bernadette nach den Heimsuchungen durch Unsere Liebe Frau gelebt hatte und verstorben war. Man hatte ihren winzigen Körper in einem gläsernen Schneewittchensarg ausgestellt, und die Leute standen jeden Tag Schlange, um sich das anzusehen – ein groteskes Bild. Es erinnerte mich an den Dubliner Zoo. Dort gab es ein Krokodil in einem Glasgehege, das genauso lang und breit wie der Körper des Tieres war, sodass es sich nicht bewegen konnte, und darin war gerade genug Wasser, um es so weit zu bedecken, dass nur noch der Rücken frei lag. In der Glasdecke befand sich eine Lücke. Die Erwachsenen warfen Münzen durch die Lücke und auf den Rücken des Krokodils, um zu sehen, ob sie es auf diese Weise ärgern konnten, denn es konnte sich ja nicht bewegen. Ich frage mich, was die Zoo-Leute mit all den Münzen gemacht haben. Bernadette starb 1879, und in den ersten dreißig Jahre danach wurde ihr Körper dreimal wieder ausgegraben, damit Menschen Teile ihrer Knochen für Altare verwenden konnten. Ein Altar ist scheinbar erst dann heilig, wenn er irgendeinen Körperteil der Toten enthält. Klingt für mich eher teuflisch als göttlich. Im Reisebus hatten wir einen Tourguide namens J. Er arbeitete für das Reisebüro unserer Heimatstadt und war sehr freundlich zu mir. Er saß vorn und hatte ein Mikrofon, um den Leuten zu sagen, was sie sehen konnten, wenn sie links oder rechts aus dem Fenster blickten. Er stimmte indes einige Lieder zum Mitsingen an, und meine Mutter schlug ein paar Mal vor, mich »Scarborough Fair« singen zu lassen, was ich auftragsgemäß tat – mit viel Gefühl, denn ich hatte mich heimlich in J. verliebt. Ich war traurig, als wir alle wieder zu Hause waren, weil ich es vermisste, ihn jeden Tag zu sehen. Ganz allein schmachtete ich und sang das Lied. Aber heute war ich es leid, und ich beschloss, die rund drei Kilometer bis zum Reisebüro zu laufen, um ihm meine Liebe zu gestehen und ihn zu bitten, mich zu heiraten. Ich kam zur Mittagszeit dort an, aber J. saß an seinem Schreibtisch, telefonierte. Mein Herz begann vor Angst zu hämmern. Mir war nie in den Sinn gekommen, dass er eine Frau haben könnte. Vielleicht sprach er gerade mit ihr. Er beendete das Telefonat und sah mich im Eingang stehen. Er winkte mich hinein; er schien überrascht zu sein, dass ein Kind allein ins Reisebüro gekommen war, um womöglich irgendeinen Ausflug buchen zu lassen. Ich sagte ihm, dass ich ihn unter vier Augen sprechen müsse. J. brachte mich in eine kleine Küche, setzte mich an den kleinen runden Tisch, goss mir ein Glas Milch ein und fragte mich, ob ich Kekse wolle. Aber ich konnte nicht essen, weil ich so liebeskrank war. Da ich nicht den Mut hatte zu sprechen und auf diese Möglichkeit vorbereitet war, präsentierte ich ihm eine schriftliche Erklärung. Er las sie, lächelte dabei die ganze Zeit über, während die Sonne durch das offene Fenster auf seine herrlichen braunen Bartstoppeln fiel. Als er mit dem Lesen fertig war, faltete er meinen Brief behutsam zusammen und fragte mich, ob er ihn behalten könne. Er sagte, dass es das Schönste sei, was er je gelesen habe, dass er aber viel zu alt sei, um mich zu heiraten oder auch nur mein Liebster zu sein, weil er schon dreißig sei, dass ich aber eines Tages einen Jungen in meinem Alter kennenlernen würde und dass das viel besser sei. Er sagte mir auch, dass er einer von den Männern sei, die andere Männer lieben. Von so etwas hatte ich noch nie gehört, also musste er es ein wenig erläutern. Er sagte, dass Gott manchmal eben Männer mache, die sich in Männer verlieben, oder Frauen, die sich in Frauen verlieben. Er fragte, ob es mir was ausmache, für mich zu behalten, was er mir da gerade erzählt habe, weil die Leute, sagte er, mit Männern, die Männer liebten, nicht einverstanden seien. Er sagte, dass die Menschen oft nicht erkennen, was Gott liebe, und er sagte, dass sie manchmal nicht das lieben würden, was Gott liebe. J. sagte mir auch, dass ich niemals glauben solle, dass irgendeine Art von Liebe falsch sei, wenn es wahre Liebe sei, und dass ich immer mutig genug sein solle, es jemandem zu sagen, wenn ich ihn liebe. Er sagte, dass ihn das sehr glücklich gemacht habe und dass es falsch sei, wenn ein Erwachsener sich einem Kind gegenüber so verhalte, als sei er sein Geliebter, darum solle ich ab heute keinem mehr sagen, dass ich ihn liebe, weil nicht alle so ungefährlich seien wie er. Als er mich fragte, warum ich ihn liebe, sagte ich, weil er so sanftmütig sei. Also sagte er, dass ich mich vergewissern solle, dass jeder, den ich liebe, sanftmütig sei. Ich könne ihn jederzeit auf ein Glas Milch und Kekse besuchen, und dass er mein Freund sei. Ich war nicht traurig. Ich hatte ihn zum Lächeln...