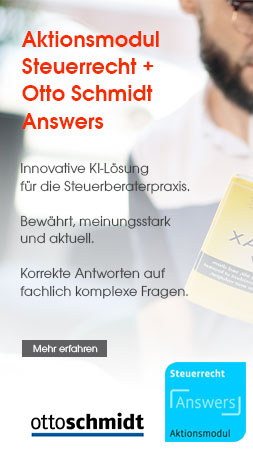E-Book, Deutsch, 272 Seiten, E-Book
Plum #steuernkompakt Buchführung
1. Auflage 2022
ISBN: 978-3-7910-5723-1
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 272 Seiten, E-Book
ISBN: 978-3-7910-5723-1
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Prof. Dr. jur. Bernhard Plum war u.a. Assistent bei Arthur Andersen, Leiter des Lektorats Elektronische Publikationen beim C.H. Beck Verlag, München und Leiter Recht und Personal sowie Prokurist bei der 118000 AG, München. Nach einem Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Ökonomie & Management in München ist er seit 2011 Professor an der Hochschule Furtwangen in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Er leitet das Gründerprojekt 'ready-study-go', das Studierende, Alumni und Mitarbeitende darin fördert, eigene Geschäftsideen umzusetzen.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1 Allgemeine Grundlagen
Auf den Punkt gebracht
Das betriebliche Rechnungswesen ist ein bedeutendes Gebiet der Betriebswirtschaftslehre. Es abstrahiert das reale Geschehen in einem Unternehmen und reduziert es auf Zahlen und Währungsbeträge. Erst hierdurch wird es möglich, die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens korrekt zu erfassen und kaufmännisch rationale Entscheidungen zu treffen.
Da an den richtigen Ergebnissen nicht nur die Geschäftsleitung, sondern auch unterschiedliche außenstehende Personenkreise interessiert sind, erfüllt das betriebliche Rechnungswesen verschiedene Aufgaben und kann dementsprechend in mehrere Teilbereiche untergliedert werden.
Die Buchführung bildet dabei das Herzstück des Rechnungswesens, indem in ihr jeder Geschäftsvorfall erfasst wird und deren Auswirkungen übersichtlich zusammengeführt werden können. Sofern diese Ergebnisse außenstehenden Personen bekanntgegeben werden müssen, ist es zwingend erforderlich, die Buchführung nach einem allgemein gültigen System durchzuführen, um deren Aussagekraft und Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen nicht zu verwässern. Insoweit bestehen zahlreiche geschriebene und ungeschriebene Regeln.
Unter dem Begriff »Rechnungswesen« versteht man die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Abgabe von Informationen über Geld- und Leistungsgrößen im Unternehmen.
1.1 Adressaten
An solchen Informationen ist eine Vielzahl von Personenkreisen aus unterschiedlichen Gründen interessiert.
Zum einen sind Adressaten die an dem Unternehmen beteiligten Personen. Solche unternehmensinternen Personengruppen sind insbesondere:
- Geschäftsleitung:
Ein Unternehmer, Geschäftsführer oder Vorstand benötigt für seine Entscheidungen eine Vielzahl von Informationen (z.B. muss er für die Festsetzung seiner Angebotspreise die Selbstkosten seiner Produkte kennen oder wissen, ob und wie er eine Investition finanzieren kann). - Mitarbeiter:
Auch die Angestellten des Unternehmens möchten wissen, wie es dem Unternehmen geht, um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes einschätzen zu können. Ebenso kann eine gute Gewinnsituation als Grundlage für Gehaltserhöhungsgespräche dienen. - Gesellschafter:
Diese sind die Eigentümer des Unternehmens. Als solche wollen sie zum einen den Wert des Unternehmens kennen. Zum anderen möchten sie auch wissen, wie hoch der Gewinn eines Unternehmens ist, um entscheiden zu können, wie viel Geld sie dem Unternehmen entnehmen (bei Einzelkaufleuten oder Personengesellschaften) bzw. als Dividende ausschütten (bei Kapitalgesellschaften) können.
Aber auch unternehmensexterne Personengruppen haben ein großes Interesse daran zu wissen, wie sich die Vermögen- und Ertragslage eines Unternehmens darstellt. Hierzu gehören beispielsweise:
- Banken:
Diese vergeben nur dann Kredite an ein Unternehmen, wenn sie dessen Bonität (also Kreditwürdigkeit) kennen. Hierfür müssen sie insbesondere wissen, ob das Unternehmen über genügend Sicherheiten und Liquidität verfügt. - Gläubiger:
Lieferanten und Kunden gehen regelmäßig nur dann Geschäftsbeziehungen ein, wenn sie sicher sein können, dass das Unternehmen auch seinen Zahlungs- und Leistungsverpflichtungen nachkommen können. - Behörden:
Hierzu gehört insbesondere das Finanzamt, dass die Höhe der Steuern entsprechend dem Gewinn (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) und der Umsätze (Umsatzsteuer) des Unternehmens festsetzt. - Kapitalanleger:
Auch potenzielle Investoren werden sich erst für ein Engagement entscheiden, wenn sie die finanziellen Details des Unternehmens kennen.
Entsprechend den verschiedenen Adressatenkreis wird das Rechnungswesen in zwei Arten unterteilt (s. Abb. 1.1).
Abb. 1.1: Einteilung des betrieblichen Rechnungswesens
1.1.1 Externes Rechnungswesen
Das externe Rechnungswesen erfolgt in der sog. »Finanzbuchhaltung«.
Diese besteht zum einen aus der Pflicht, sämtliche Geschäftsvorfälle eines Unternehmens aufzuzeichnen (in der Regel im Rahmen der sog. »doppelten Buchführung«) und gipfelt in der Pflicht, jährlich einen sog. »Jahresabschluss« zu erstellen.
Gemäß § 242 Abs. 3 HGB besteht der Jahresabschluss zumindest aus einer Bilanz, in der das Vermögen und das Kapital des Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag (sog. »Bilanzstichtag«) aufgeführt ist, und einer Gewinn- und Verlustrechnung (kurz »GuV«), in der die Erträge und Aufwendungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr gegenübergestellt werden und ein erzielter Gewinn bzw. Verlust (sog. »Betriebsergebnis«) ausgewiesen wird.
Bei bestimmten Arten von Unternehmen (insbesondere bei Kapitalgesellschaften) besteht weiterhin gemäß § 325 Abs. 1 Satz 2 HGB die Pflicht, diesen Jahresabschluss elektronisch im Bundesanzeiger offenzulegen (zu »publizieren«).
Zum anderen sind Unternehmen verpflichtet, jährlich eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.
Damit sich externe Adressaten auf die Angaben zur Vermögens- und Ertragslage im Jahresabschluss verlassen können und eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Jahresabschlüsse gewährleistet ist, ist die Finanzbuchhaltung hochgradig reglementiert und von zahlreichen Rechtsquellen bis ins Detail geregelt.
1.1.2 Internes Rechnungswesen
Das interne Rechnungswesen erfolgt in der sog »Kosten- und Leistungsrechnung« (auch »Betriebsbuchhaltung« oder nur kurz »Kostenrechnung«) und in der »Planungsrechnung«.
Im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung besteht zur Durchführung einer Kosten- oder Planungsrechnung keine gesetzliche Verpflichtung. Allerdings ist kein Unternehmen ohne eine aussagefähige Betriebsbuchhaltung überlebensfähig. Das Ziel der nachhaltigen Gewinnmaximierung kann nämlich nur dann erreicht werden, wenn der Prozess der Leistungserstellung nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip erfolgt.
Die Aufgaben der Kostenrechnung bestehen somit in der
- Erfassung (Kostenartenrechnung),
- Verteilung (Kostenstellenrechnung) und
- Zurechnung (Kostenträgerrechnung)
der Kosten, die bei der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung entstehen, um
- eine Entscheidungsgrundlage für betriebliche Dispositionen zu schaffen und
- eine wirksame Kostenkontrolle zu ermöglichen.
Die Planungsrechnung hingegen ist eine betriebs- oder unternehmensbezogene Vorschaurechnung, die Zukunftsdaten hinsichtlich relevanter Bereiche prognostiziert. Sie wird auch als Budgetierung bezeichnet und ist zugleich ein Teilgebiet des Controllings.
Mit ihrer Hilfe lassen sich für einen Unternehmer viele Fragestellungen beantworten. Hierzu gehören insbesondere:
- Kalkulation der Selbstkosten zur Festlegung des Angebotspreises,
- Entscheidungsrechnungen,
- Kostenmanagement.
1.2 Aufgaben des Rechnungswesens
Im Allgemeinen hat das Rechnungswesen die Aufgabe, das gesamte Unternehmensgeschehen zahlenmäßig zu erfassen, zu überwachen und auszuwerten. Im Besonderen sind die in Abb. 1.2 dargestellten Aufgaben zu unterscheiden.
Abb. 1.2: Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens
1.2.1 Dokumentationsaufgabe
Gemäß § 239 Abs. 2 HGB sind die Geschäftsvorfälle des Unternehmens vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen, wobei die Dokumentation so zu erfolgen hat, dass sich diese in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehen lassen (vgl. § 238 Abs. 1 Satz 3 HGB).
Bei der Dokumentationsaufgabe erfolgt daher die zeitliche, sachliche und geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsfälle anhand von Belegen, die das Eigen- und Fremdkapital, die Vermögenswerte und ebenso den Jahreserfolg des jeweiligen Unternehmens verändern.
1.2.2 Rechenschaftslegungs- und Informationsaufgabe
Nach § 238 Abs. 1 HBG sind Unternehmen verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen die Lage des Vermögens ersichtlich zu machen, wobei die Buchführung so beschaffen sein muss, dass sie einem sachverständigen Dritten in angemessener Zeit einen Überblick über die Lage des Unternehmens verschafft.
Hieraus folgt die Pflicht der periodenweisen (jährlichen) Berichterstattung an Unternehmenseigner, Behörden,...