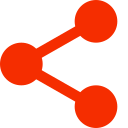E-Book, Deutsch, 118 Seiten
Sachse Selbstregulation und Selbstkontrolle
1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-8444-3046-2
Verlag: Hogrefe Publishing
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 118 Seiten
ISBN: 978-3-8444-3046-2
Verlag: Hogrefe Publishing
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Das Buch erörtert die psychologischen Aspekte einer funktionalen Selbstregulation, also von Prozessen, die zwischen den Anforderungen des Kontextes („der Realität“) einerseits und den Ansprüchen des eigenen Motiv-Systems vermitteln und die zu tragfähigen Entscheidungen einer Person führen. Daher werden insbesondere die motivationalen Faktoren genau analysiert und die Bedeutung impliziter Motive hervorgehoben.
Von Selbstregulation wird Selbstkontrolle abgegrenzt, also der Prozess, bei dem eine Person eigene Ziele gegen anderslautende motivationale Tendenzen durchsetzt. Es wird aufgezeigt, dass Selbstkontrolle und Selbstregulation sich sowohl widersprechen als auch ergänzen können. Selbstkontrolle kann durchaus ein wesentlicher Aspekt einer funktionalen Selbstregulation sein.
Abschließend wird die Relevanz des vorgestellten Modells für die klinische Psychologie und die Psychotherapie aufgezeigt.
Zielgruppe
Psychotherapeut_innen, Psychiater_innen, Klinische Psycholog_innen, Studierende der Psychologie.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Sozialwissenschaften Psychologie Psychotherapie / Klinische Psychologie Beratungspsychologie
- Sozialwissenschaften Psychologie Psychotherapie / Klinische Psychologie Psychopathologie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, Suchttherapie
Weitere Infos & Material
|6|3 Ein theoretisches Modell der Selbstregulation
Es soll nun ein theoretisches Modell entwickelt werden, durch welche psychologischen Faktoren bzw. ihre Interaktion eine effektive Selbstregulation zustande kommt. Dies kann wegen der enormen Komplexität des Sachverhalts aber nur ein vereinfachtes Modell sein: Ich möchte hier vor allem solche Faktoren aufführen, die aus psychotherapeutischer Sicht relevant sind. Eine zentrale Aufgabe einer Person besteht darin, Anforderungen der „Realität“ und Anforderungen des eigenen Motivsystems in Einklang zu bringen: Psychologisch ist dies eine immer vorhandene, schwierige Aufgabe, die nie ideal, sondern höchstens optimal gelingt. Es geht darum, eine Balance zwischen den zwei Anforderungen zu finden: Diese Balance wird aber immer wieder durch neue Anforderungen der Realität gestört sowie auch durch neu aufkommende Motive und Bedürfnisse. Eine Person muss daher diese Balance immer wieder neu herstellen, und dies gelingt ihr nur mehr oder weniger gut. Eine Person kann hier zwei Arten von Fehlern machen: Sie kann sich zu stark an den Anforderungen der Realität orientieren bzw. an internalisierten Normen, wodurch sie das eigene Motivsystem ignoriert, Unzufriedenheit und viele typische Kosten schafft. Sie kann sich aber auch zu stark am eigenen Motivsystem orientieren, wodurch sie mit den Anforderungen der Realität in Konflikt gerät, was wiederum bestimmte Arten von Kosten erzeugt. Der Prozess der Selbstregulation beginnt mit den Anforderungen, die das Motivsystem und die Realität, der Lebenskontext des Klienten, stellen und die die Person erkennen, beachten und analysieren muss. Die Person muss Abwägungen und Entscheidungen treffen, sie wird aber dabei auch beeinflusst von affektiven und kognitiven Schemata, expliziten Motiven, Wissen und Realitätsmodellen: Und alle diese Aspekte können die Entscheidungsfindung funktional, aber auch dysfunktional beeinflussen. |7| |8|Ein Modell der Selbstregulation ist in Abbildung 1 dargestellt. Hier sollen zunächst einmal die relevanten Aspekte des Modells in der Übersicht dargestellt werden. Auf besonders relevante Aspekte wird dann im Folgenden noch ausführlicher eingegangen. Im Folgenden sollen Komponenten des Modells näher erläutert werden. 1. Kontexte Personen leben in bestimmten Kontexten: Diese stellen bestimmte Anforderungen an die Person. Sie bestimmen, welche Ziele und Motive sich (wie) erreichen lassen, welche Probleme (dabei) auftreten. Sie beschränken den Handlungsspielraum und bestimmen, welche Konsequenzen (positive wie negative) aus Handlungen resultieren (vgl. Hogg & Vaughan, 2010; dies wird besonders deutlich in Studien zum interkulturellen Vergleich (Berry et al., 1997; Bonta, 1997; Hogg & Tindale, 2005; Hogg & Turner, 1987; Lehman et al., 2004; Smith et al., 2006; Smith & Bond, 1998; Triandis et al., 1980)). Dabei geht es sowohl um die engeren Lebenskontexte der Person wie Arbeit und Beruf, Partnerschaft, Familie und Freizeit etc. Man kann annehmen, dass zur Erreichung von Zufriedenheit ein gutes „Funktionieren“ besonders in den Bereichen „Partnerschaft“ und „Arbeitskontext“ wichtig ist. Der Kontext bestimmt in hohem Maße, welche positiven oder negativen Konsequenzen ein bestimmtes Handeln hat, er definiert Erwartungen, Normen, Regeln. Diesen Erwartungen usw. muss eine Person gerecht werden, damit ihr Handeln positive Konsequenzen erzeugen kann (die wiederum auch Ziele und Motive befriedigen können) und negative Konsequenzen („Kosten“) vermieden werden. In diesem Kontext (der „Realität“) muss eine Person zurechtkommen, denn der Kontext determiniert, welche Ziele eine Person erreichen kann, welche Motive sie befriedigen kann, aber auch, welche Kosten der Person entstehen, wenn sie gegen Erwartungen etc. verstößt. Die Person muss diesen Anforderungen in bestimmter Weise gerecht werden, um Kosten zu vermeiden, aber auch, um bestimmte Motive überhaupt befriedigen zu können. Damit ist erkennbar: Den Anforderungen des Kontextes zu entsprechen, bedeutet letztlich auch wieder, eigene Motive optimal befriedigen zu können, also deutliche persönliche Gewinne und möglichst geringe persönliche Kosten zu produzieren: Letztlich geht es damit gar nicht um die Anpassung an Kontexte, sondern um die Regulation innerer Befindlichkeiten. Andererseits hat die Person Einfluss auf den Kontext und eine (begrenzte) Kontrolle über ihn. Ihre Handlungen üben Einfluss auf den Kontext aus und haben wieder bestimmte Konsequenzen (vgl. Furnham, 2003; Jonas et al., 2007; |9|Lerner, 1977). So kann sie selbst viel zum Gelingen einer Partnerschaft beitragen, kann in gewissem Ausmaß ihren beruflichen Erfolg steuern oder sie kann viel dazu beitragen, dass ihre Beziehung (Sachse & Sachse, 2006) oder ihre Karriere scheitert (Sachse & Collatz, 2012). 2. Verarbeitung Der Kontext wird von der Person verarbeitet (Förster & Liberman, 2006; Strack, 1992): Die Verarbeitung wird dabei beeinflusst von Wissen, früheren Realitätsmodellen, Schemata, Emotionen (Forgas, 2002; Schwarz, 2001). Man kann theoretisch darüber diskutieren, ob eine Person in der Lage ist, „die Realität“ wirklich valide wahrzunehmen (Bunge & Mahner, 2004; Vollmer, 1975, 2003). Was man aber sicher sagen kann, ist, ob ein Realitätsmodell im Kontext des Klienten funktioniert: Dies tut es dann, wenn es mehr Gewinne als Kosten erzeugt, und es funktioniert dann nicht, wenn die Kosten überwiegen. Personen können demnach ihre Realitätsmodelle immer „empirisch testen“. Die Person kann Modelle über die Realität bilden, die unterschiedlich gut elaboriert sind, unterschiedlich differenziert, sodass sie unterschiedlich gute Interpretationen aktueller Situationen erlauben. Die Person zieht aus Daten Schlussfolgerungen und bildet Hypothesen. Diese sind immer Konstruktionen, sie bilden die Realität nicht 1 zu 1 ab. Eine Person kann aber relativ gute, in der Realität gut funktionierende Konstruktionen aufweisen oder schlechte Konstruktionen, die zu Fehlern bei Entscheidungen und Handlungen führen. Dies impliziert auch, dass die Kontexte, in denen eine Person lebt, nie einen „direkten“ Einfluss ausüben: Die Kontexte werden immer interpretiert (wie noch ausgeführt wird) durch Schemata, Realitätsmodelle, emotionale Verarbeitungen etc. „Verarbeitung“ impliziert aber auch die Reflektion über eigene Denk- und Entscheidungsprozesse, also darüber, wie man denkt, ob das Denken korrekt ist usw.: Damit sind hier ebenfalls metakognitive Prozesse von Bedeutung (Dinsmore et al., 2008; Efklides, 2008; Kaplan, 2008; Kitsantas et al., 2008). 3. Schemata Auf den Begriff und die Bedeutung von Schemata wird in Kapitel 6 näher eingegangen werden: Hier soll aber vorab eine kurze Einführung gegeben werden. Schemata bestimmen in hohem Maße die aktuelle Situationsinterpretation: Sie bestimmen, wie die Situation aufgefasst wird, welche Aspekte fokussiert und welche ausgeblendet werden. Sie bestimmen auch systematische Verarbeitungsfehler etc. (vgl. Anderson, 1981; Abelson, 1981; Fiske & Taylor, 1991, 2008; Forgas, 2002, 2006; Rumelhart & Ortony, 1977). Schemata können dazu beitragen, dass eine Person gut funktionierende Realitätsmodelle bildet oder Modelle, die zu Pro|10|blemen führen (Beck, 1979; Beck & Emery, 1981; Beck et al., 1961, 1976, 1981, 1993, 1997; Beck & Greenberg, 1979). Schemata sind Annahmen, Überzeugungen, die die Person von sich selbst hat (Selbstschemata), die sie über Beziehungen hat (Beziehungsschemata) oder die sie über Realität hat (Realitätsschemata). Diese Annahmen bilden sich in der Biographie. Funktionale Schemata wie hohe Selbsteffizienzerwartung, positive Selbsteinschätzung, Handlungsorientierung u.?a....