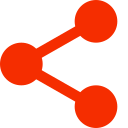E-Book, Deutsch, 548 Seiten
Stein Grenzterror
2. Auflage 2018
ISBN: 978-3-7528-8990-1
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
E-Book, Deutsch, 548 Seiten
ISBN: 978-3-7528-8990-1
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
Im Zentrum des Buches steht die 4½jährige DDR-Haft des Thomas S. Eine sehr persönliche Geschichte. 1972 versucht er mit 15, in den Westen abzuhauen, wird zu Jugendhaus verurteilt und im Gefängnis vergewaltigt. 1976 sperrt ihn die Stasi wegen Republikflucht und Grenzterror ein. Auf GRENZTERROR stand in der DDR 1976 noch die Todesstrafe! In der fiktiven Rahmenhandlung erregt sich der Autor über die GEZ-Abzocke. Ab 2013 ist jeder Bürger verpflichtet den Beitrag zu zahlen, selbst wenn er Funk und Fernsehen verweigert. Ist das nicht so, als müssten alle Hundesteuer entrichten, auch diejenigen, die keinen Vierbeiner besitzen? Er taucht in die Nacht des 13.10.1977 ein. Beamte finden in Stammheim Jan Karl Raspe auf dem Bett, röchelnden an die Wand gelehnt. Selbstmord? War die Pfarrerstochter aus der Uckermark 2002 wirklich ein Buschzäpfchen, wie eine Zeitung schrieb, oder einfach nur ziemlich clever? Wir ziehen an der Seite der USA in den Krieg, indem wir den trügerischen Frieden der Gegenwart durch einen Krieg in einen wirklichen Frieden der Zukunft verwandeln, so tönt sie in Amerika. Nach Meinung des Autors spielte der Auftritt Angies in den Medien der USA Kanzler Schröder mehr in die Hände, als die Flutkatastrophe. Blättern sie in diesem Buch mit dem Bischof von Jerusalem die Bibel durch und wundern sie sich über einige ihrer Widersprüche. Erfahren sie mehr über den Antijudaisten Luther und wie man eine Ehe katholisch wirksam annulliert. Löst die Künstliche Intelligenz den Menschen als Krone der Schöpfung ab? Sind dann nicht mehr Gene, sondern Programme wahres Leben, dessen Substrat der Siliziumchip und nicht die Aminosäure ist? Ein spannend zu lesendes, manchmal bis an die Grenze des Erträglichen reichendes Zeitzeugen-Dokument. Die 620 Seiten, 200.280 Worte, 93 Ablichtungen, sind Autobiographie und Roman in einem.
Der Autor ist geweihter Bischof von Jerusalem, weigert sich aber beharrlich das ihm übertragene Amt anzutreten. An Krebs erkrankt lebt er nach dem Motto: Das Leben ist unsicher, darum iss den Nachtisch zuerst.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Im August 1972 war ich 15 Jahre alt geworden. Es gab in Berlin und Umgebung beinahe keinen zugänglichen Mauer- oder Grenzbereich, den ich nicht mindestens einmal zu Fuß besichtigt oder mit der S-Bahn befahren hatte. Für einige Grenzabschnitte benötigte man einen speziellen Grenzausweis, den ich natürlich nicht besaß. Auch für die verschlossenen U-Bahn Eingänge hatte ich mich interessiert. Deren darunter liegende Geisterbahnhöfe wurden nicht nur von Grenzsoldaten, sondern auch von der Transportpolizei in blauen Uniformen, die aber nicht nur mit einer Makarow, sondern auch mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, bewacht. Oft ging ich nach der Schule allein los, manchmal aber auch zusammen mit meinem Schulkammeraden Norbert. Natürlich war unser gemeinsames Ziel abzuhauen. In den Westen zu gelangen, das Unmögliche zu vollbringen. Der Westen, das war für uns ein riesiger Intershop, dessen unvergleichbarer Geruch Grund genug war, dem geruchslosen, hier und da sogar stinkenden Osten, den Rücken zu kehren. In einem Laubengelände hinter dem S-Bahnhof Plänterwald wurde ich, damals noch 14 Jährig, im Grenzgebiet durch eine Motoradstreife der Grenztruppen angehalten und weil ich keinen Grenzausweis besaß, an die Polizei in Zivil, oder war es womöglich die Staatssicherheit, übergeben. Die Zivilpolizisten saßen in einem Bauwagen, der mit Heizung und Telefon ausgestattet war und trugen große Pistolen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Die Makarow der Volkspolizei und die Kalaschnikow der Grenztruppen waren jedem Berliner Jungen, der sich nur ein Wenig für Waffen interessierte, bekannt. Die Polizisten machten mir ordentlich Angst. Sie behaupteten, dass ich eine Straftat begangen hätte, ließen mich aber, nach einer gründlichen Durchsuchung und einem Telefonat mit meine Mutter laufen. Ich hatte im Verhör erwähnt, dass sie SED Genossin sei. Jetzt gibt es Stubenarrest für dich, gab mir der eine noch mit auf den Weg. Sofort und ohne Umwege oder Abkürzungen nach Hause: Abmarsch! Ich hatte ihnen auch erzählt, dass ich über einen Schleichweg hinter dem Bahnhof nach Hause wollte und dass dort kein Schild mit der Aufschrift Grenzgebiet stand. Der eine von den beiden Polizisten bestätigte das und meinte zu seinem Kollegen, dass man darüber erneut eine Meldung schreiben müsse, weil auf diesem Trampelpfad immer wieder Personen aufgegriffen würden, die nur den Heimweg abkürzen wollten. Am 15. November 1972 sollte die Flucht nach Westberlin gelingen. Der November war die beste Jahreszeit für dieses Vorhaben. Abends konnte man kaum noch die Hand vor Augen erkennen. Wir hatten uns unter vielen anderen Möglichkeiten dafür entschieden, auf eine langsam fahrende S-Bahn aufzuspringen, die nach Westberlin fuhr. Ich hatte mir den Hof am ehemaligen Schiffbauerdamm vor drei Tagen, da war es besonders neblig, gegen 19.00 Uhr genau angeschaut. Der Hinterhof hatte kein Licht. Ab und zu wahren hinter den erleuchteten Fenstern Hausbewohner zu sehen aber die sahen mich auf dem dunklen Hof wahrscheinlich nicht. Etwa fünf Meter über mir rumpelte gemächlich die hell erleuchtete S-Bahn vorbei und erhellte den Hof. Ich kauerte mich hinter den Mülltonnen zusammen, um nicht doch noch gesehen zu werden. Kurz hinter der Eisenbahnbrücke fuhr die S-Bahn wirklich nur noch Schritttempo. Die fährt zum Bahnhof Zoo hatte mir mal ein betrunkener Eisenbahner gesagt. Aber da kommst du erst mit 65 hin. Der Bahnhof Friedrichstraße war ein Grenzbahnhof. Auf der Ostseite endeten hier mit Ausnahme des Gleisbauzuges alle S-Bahnen um dann in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren. Hier war für den Ostberliner die Welt zu ende. Der Gleisbauzug fuhr drei Mal pro Woche in den Westen. Er hielt, vom Betriebsbahnhof Schöneweide kommend, an jedem S-Bahnhof und fuhr dann tatsächlich auf der Westseite des Bahnhofes Friedrichstraße ein. Ich hatte jedoch beobachtet, dass er dort sehr genau, auch mit Hunden, kontrolliert wurde. Es wäre auch zu schön gewesen! Es gab zwei Gleise auf der Ostseite des Bahnhofes Friedrichstraße. Eins zum Tränenpalast hin gelegen und das andere direkt gegenüber dem Westbahnhof. Wenn man dahin gelangen konnte, hatte man es geschafft. Die Teilung des Bahnhofes bestand aus einem vier Meter hohen Metallrahmengestell in das dicke Drahtglasscheiben eingelassen waren. Ich konnte die S-Bahn auf der anderen Seite des Bahnhofes, also der Westseite, zwar durch das geriffelte Draht-Milchglas nur verschwommen sehen, aber sie beinahe mit den Händen berühren. Natürlich hatten wir überlegt, ob es da keinen Weg drüber, oder hindurch gäbe, aber die Grenzposten mit Maschinenpistolen, die von einem Laufgang direkt unter dem gewölbten Dach an beiden Enden des Bahnhofes alles überblicken konnten, ließen uns diesen Plan recht bald vergessen. Bundesbürger mit dem richtigen Pass, oder Westberliner Personalausweis, Ausländer und natürlich Ost-Rentner, die einen blauen DDR Reisepass erhalten hatten und damit in den Westen reisen durften, waren vorher durch den Tränenpalast gegangen. So hieß die Grenzübergangsstelle am Bahnhof Friedrichstraße im Volksmund. War doch ganz einfach. Pass und Visum vorzeigen und in wenigen Minuten stand man auf der anderen Seite des Bahnhofs. Und trotzdem wurde immer wieder geschimpft, wenn sich meist am Wochenende mal längere Schlangen vor der Ausreise gebildet hatten. Die S-Bahn Richtung Bahnhof Zoo, in der die bereits kontrollierten und für reisewürdig befundenen Menschen saßen um in das NSA, das „Nicht Sozialistische Ausland“, also in diesem Fall nach Westberlin zu reisen, fuhr dann über die Brücke am ehemaligen Schiffbauerdamm. Die Strecke führte kurvig weiter, neigte sich zudem stark nach rechts und die Geschwindigkeit wurde auf Schritttempo heruntergefahren. Auf einer Signalanlage mit Laufsteg stand ein Postenhaus, in dem zwei Grenzsoldaten die Gleise beobachteten, aber bei Nebel konnten die, trotz ihrer Ferngläser, nicht allzu weit sehen. Ich hatte bei meinen Beobachtungen festgestellt, dass sie sich immer nur zeigten, wenn ein Zug vorbei fuhr. Aber nicht nur die Grenzer waren für uns gefährlich. Die S-Bahn gehörte zur Deutschen Reichsbahn und das Fahrpersonal kam aus dem Osten. Natürlich durfte der S-Bahnführer das Aufspringen auf seinen Zug auch nicht bemerken. Für den Fall, dass es uns nicht gelingen sollte, auf die langsam fahrende S-Bahn aufzuspringen, wollten wir daneben herlaufen. Und wenn sie schießen, fragte Norbert? Die schießen nur, wenn sie uns sehen, hatte ich erwidert und hinzugefügt: Na und? Dann laufen wir weiter! Schießen und Treffen sind zwei verschiedene Paar Schuhe! Das wusste ich aus dem Film 4 Panzersoldaten und ein Hund. Auf den Scharik, so hieß der mutige Schäferhund, wurde von den Deutschen auch immer wieder geschossen, aber die haben ihn nie getroffen. Man musste nur schnell und wendig sein. Das eigentliche Problem bestand darin, über den Hinterhof eines, der an den Bahndamm grenzenden Häuser, auf die Gleisanlagen zu gelangen. Da blieb nach gründlicher Ausspähung nur ein Haus übrig, das dafür geeignet erschien und dessen Hoftür nicht verschlossen war. Leider konnte ich mir die Gleisanlagen von dort aus nicht von Oben anschauen, weil sich die Eisentür des Dachbodens nicht öffnen ließ. Bei meiner Suche hatte ich auch in anderen Häusern nachgeschaut und bin jedes Mal bis zum Dachboden hinaufgestiegen, um mir über das Dachfenster ein Bild von der Lage machen zu können, aber die Dachböden in den Häusern waren genauso verschlossen wie die Hinterhöfe. Doch einen zugänglichen Dachboden, der sich als wahrer Glücksfall erwies, fand ich dann doch vier Häuser weiter. Ich konnte zwar vom Dachfenster aus wegen des Nebels unten absolut nichts erkennen, aber auf dem Boden stand eine massive Holzleiter, mindestens zwei Meter lang. Die Bahnstrecke selbst war mit einem drei Meter hohen Metallgitterzaun und am unteren Ende des Zaunes mit Stalinrasen, der etwa einen Meter in den Hof hineinreichte, gesichert. Der „Stalinrasen“ bestand aus Zaunfeldern, deren angespitzte, 20 cm lange Stahldornen, nach oben und nach unten stehend, so angebracht waren, dass man sich Knöchel und Hände böse verletzen musste, wenn man über keine Hilfsmittel verfügte, um darüber hinwegzukommen. Ohne Leiter und mindestens zwei dicken Brettern ging hier absolut nichts. Die Leiter war kein Problem. Die stand, wie für uns hingestellt, vier Häuser weiter auf dem unverschlossenen Dachboden. Die guten alten breiten Hobeldielen lagerten im Keller meiner Mutter. Keiner hatte eine Verwendung dafür, aber bei jedem Umzug wurden sie mitgenommen. Meine Mutter wollte sie beim letzten Wohnungswechsel stehen lassen, aber die Oma sagte: Die ziehen mit um, wer weiß wozu die mal gut sind! Wie Recht sie hatte. Alle 30 Minuten fuhr abends die S-Bahn nach Westberlin, mehr oder weniger pünktlich. Da konnte eigentlich nichts schief gehen. Wir hatten uns für 22.00 Uhr am Hinterausgang des Hauses, in dem ich mit meiner Mutter wohnte, verabredet. Wie schön, dass es in der DDR kaum Klamotten in Signalfarben gab. So viel mir die Auswahl des schwarzen Trainingsanzugs und meines alten dunkelblauen Anoraks nicht schwer Der lag gut am Körper an. Norbert wohnte im BVG-Block Pattere,...