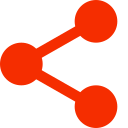E-Book, Deutsch, 256 Seiten
Taubitz Dunkeldeutschland
3. Auflage 2020
ISBN: 978-3-7519-7590-2
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 256 Seiten
ISBN: 978-3-7519-7590-2
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Vom Fremdsein im eigenen Land Ein Krankenhauszimmer. Im Bett eine Frau an Apparaten, sie schwebt zwischen Leben und Tod. Am Bett ihr Bruder, der bis vor kurzem nichts ahnte von dieser Schwester: Er ist in der DDR aufgewachsen, sie in Westberlin. Der Mann erzählt ihr von der gemeinsamen Mutter, die sich zwischen Arbeit, Waschbrett und saufenden Liebhabern aufrieb. Er erzählt von seinem Vaterland, dessen übergriffige "Liebe" ihn zur Republikflucht trieb. Und er dringt ungefragt in das Leben seiner Schwester ein. DUNKELDEUTSCHLAND breitet eine Kindheit und Jugend in der DDR aus. Der autobiografische Roman kreist am Einzelschicksal um die Frage, was das Aufwachsen in einer Diktatur mit Menschen macht. Inwieweit prägt Geschichte persönliche Geschichten? DUNKELDEUTSCHLAND ist auch eine Allegorie auf das ungeklärte Verhältnis von West- und Ostdeutschland - und ein sehr persönliches Buch. Die Erinnerungsarbeit des Erzählers beschwört den Geist eines toten Landes und hinterfragt zugleich den Zustand der vereinten Bundesrepublik. »Eindringliche Reality Fiction, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und herpendelt« Für Leser von Karl Ove Knausgard, Eugen Ruge und Sasa Stanisic. PRESSESTIMMEN "Ein Buch, das nachdenklich macht, und auch eins zum herzhaft Lachen." Andreas Ulrich, radioeins (RBB) "Sehr bewegend. Ein schöner Roman - und ein spannender Beitrag zur deutsch-deutschen Völkerverständigung." Nabil Atassi, Pop-Talk.de
UDO TAUBITZ kam womöglich mit einem Stift in der Hand auf die Welt. Sicher ist, dass er schon als Schüler in der DDR für eine Tageszeitung schrieb - bis zum Schreibverbot. Er wurde Schmuckverkäufer, Fotograf, Republikflüchtling. Dann studierte er Literatur, Soziologie sowie Journalistik. Er schrieb u.a. für Stern, Financial Times, Woman, Spiegel Online; seine Radiobeiträge sendeten Deutschlandfunk, ORF, Schweizer Rundfunk und viele mehr. Heute lehrt er als freier Schreibtrainer u.a. an der Deutschen Presseakademie (depak) und an der SCM - School for Communication and Management. Sein Kinderbuch "Karl Klops, der coole Kuhheld" wurde mit dem PETA Progress Award ausgezeichnet. Es folgten "Ben Biemer - APP ins All", "Schweinchen Schlau" sowie "Nelli und der Neidwichtel". "Dunkeldeutschland" ist sein erster Roman. Udo Taubitz lebt in Hamburg.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
EINS
Sie atmet ein. Atmet aus. Ein. Aus. Ein. Kaum sichtbar. Die weiße Bettdecke, die den Körper der Frau umhüllt, hebt sich nur zwei Millimeter, wenn sie einatmet. Der schmale Mann, der neben ihr am Bett sitzt, misst das gerade nach, mit der grünen Plastikspritze, die er vorhin im Schwesternzimmer gekrallt hat. Er zieht den Kolben heraus und setzt ihn sacht auf den Brustkorb der Frau, beim Luftholen drückt sie den Kolben zwei Striche auf der Spritzenskala rein. Der Mann weiß nicht, was er mit dieser Zahl anfangen soll. »Sie schwebt zwischen Leben und Tod«, hat ihm der Arzt vorhin gesagt. Das Schweben scheint der Frau leicht zu fallen. Sie liegt da, ganz ruhig, auf dem Rücken ausgestreckt. Ihr kantiges Gesicht mit dem spitzen Kinn unter dem engen Kopfverband erinnert an das einer Gottesanbeterin. Es wirkt entspannt. Als würde sie meditieren. Fast ein feierliches Bild, wären da nicht diese Schläuche und Drähte und die Kurven auf den Monitoren der Apparate, leuchtend rot, grün, gelb. »Hörst du mich?«, fragt der Mann leise. Er schaut die Frau nicht an, seine Augen haften am Fußboden. »Br --- Britta? Kannst du mich hören?« Er wagt kaum zu atmen, wartet auf eine Antwort, die nicht kommt, nicht kommen kann. »Vielleicht kannst du das, vielleicht kannst du hören, hat der Arzt gesagt.« Der Mann räuspert sich, schaut der Frau kurz ins Gesicht, tastend, dann starrt er wieder auf das graue Linoleum. »Womöglich fragst du dich gerade, wer mit dir spricht!? Du kennst meine Stimme nicht. Gesehen hast du mich ja schon, im Internet, du hast mich gegoogelt, schreibst du in deinem langen Brief; du hast dir also schon ein Bild gemacht von mir«, er gluckst, »wahrscheinlich ein falsches.« Der Mann verzieht sein Gesicht plötzlich zu einem breiten Grinsen und strahlt die Frau an. Sie reagiert nicht, ihre Augen sind zu. Er schaltet das Grinsen wieder ab und dreht seinen Kopf ruckartig zurück nach unten. Mühsam spricht er weiter. »Auf den Fotos, die ich nach draußen gebe, lächle ich breit, freundlich-verbindlich wie ein Versicherungsvertreter. In echt sind meine Zähne nicht so weiß. Und das Was-bin-ich-gut-drauf-Grinsen entspricht auch nicht meiner Natur. Papa, in deinen Augen tief drin steckt so viel Traurigkeit, hat meine Mittlere neulich gesagt.« Der Mann hebt den Blick zu der Frau. Aber sie kann die Trauer in seinen Augen unmöglich sehen, auch sonst nichts, zumindest nicht mit ihren Augen; sie hält ihre Lider geschlossen. »Britta. Britta. Britta«, bettelt er. Die Ärzte haben ihm gesagt, er soll sie immer wieder mit ihrem Namen anreden. Damit sie sich gemeint fühlt. Damit ihr Bewusstsein die Schwerkraft wiederfindet. Damit sie sich erinnert an ihr Britta-Leben und sich entschließt, aus der Schwebe zurückzukommen. Auch wenn‘s da vielleicht leichter ist als auf dem Boden der Tatsachen. Wer weiß. Der Mann sieht auf, lässt seinen Blick durch das Krankenhauszimmer schweifen. Die weißen Wände geben keinen Halt. Er schließt die Augen, ein kurzes Zittern durchfährt seinen schlaksigen Körper. Er beugt sich vornüber, faltet die Hände auf dem Schoß. »So sieht‘s also aus, unser erstes Date, meine Neuschwester«, flüstert er. »Britta!« Sie ist achtundvierzig. Zu alt für eine Schwester, die ich zum ersten Mal sehe, fährt es ihm durch den Kopf. Er ist neunundvierzig, nur siebzehn Monate älter als sie. Gleich nachdem die gemeinsame Mutter das Mädchen rausgepresst hatte, gab sie es zur Adoption frei. So steht es auf der Geburtsurkunde, der Vermerk in kleiner Handschrift reingequetscht zwischen den wackeligen Schreibmaschinenzahlen und dem Siegel der DDR, Hammer und Sichel im Ährenkranz. Wie das Mädchen damals aus dem tief ostdeutschen Calau zu Adoptiveltern nach Westberlin gekommen ist – ein Rätsel. Und keiner mehr da, den man fragen könnte. Erst beim Entrümpeln der Wohnung ihrer Zieheltern hat sie entdeckt, dass die Menschen, die sie Mama und Papa nannte, nicht ihre echten Eltern waren. Aber die Geburtsurkunde ist eindeutig. Sie hat sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter gemacht. Ihrer Mutter. Seiner Mutter. Sie hat sie aufgespürt, ein paar Jahre zu spät, im Pflegeheim für Demente. Als sie die alte Frau besuchte, hielt die ihre verlorene Tochter für ihre Mutter und bettelte, dass sie ihr Hänsel und Gretel vorsingt. Und dann hat die Frau monatelang nach ihren drei Halbgeschwistern gefahndet. Und den Mann gefunden, ihren Bruder. Jetzt sitzt er hier neben ihr, im Krankenhaus, in diesem weißen Zimmer unter Neonlicht. Er fühlt sich unwohl. Fehl am Platz, neben der fremden Frau, die seine Schwester sein soll, seine Schwester ist. Seine Halbschwester, genau genommen, aber das macht für ihn keinen Unterschied, auch mit seinen richtigen Geschwistern, die beiden, mit denen er aufgewachsen ist, teilt er nur das Blut der Mutter. Er zieht einen zerknitterten, hellblauen Brief aus der Innentasche seines Sakkos, ohne Kuvert. Es ist der Brief, den seine neue Schwester, neben der er nun hier im Krankenhaus sitzt, ihm vor ein paar Wochen geschickt hat. Er wedelt mit dem linierten Papier vor ihren Augen herum. »Warum redest du mich nicht mit Namen an?«, fragt er, aber diesmal wartet er nicht auf Antwort. »Mein lieber großer Bruder, so schießt du einfach los.« Als er das gelesen hatte, vor ein paar Wochen in seinem Arbeitszimmer, und langsam begriff, was diese Worte meinten, war es, als ob sich seine inneren Erdplatten urplötzlich verschoben, hier auseinanderdrifteten und dort sich neu verkeilten. Bisher war er immer nur der kleine Bruder gewesen. »Entschuldige«, wimmert er plötzlich, »wir hätten wirklich erst mal telefonieren sollen, statt uns gleich zu treffen.« Er lässt den Brief fallen, schlägt die Hände vors Gesicht. »Du lägest jetzt nicht hier, halbtot, wenn wir erst mal telefoniert hätten. Aber ich konnte das nicht, verstehst du? Ich kann am Telefon Seminarthemen besprechen, Honorare aushandeln und Friseurtermine buchen. Kein Ding. Aber Gefühlsdinge am Telefon – da verstocke ich komplett. Frag meine Frau.« Der Mann atmet jetzt schwer. »Am Telefon könnte ich nie so etwas Schwerwiegendes sagen wie Ich liebe dich. Noch weniger als sonst schon.« Der Mann fängt an zu schluchzen. Das Weinen wärmt seine Brust, wie er feststellt, angenehm überrascht; etwas löst sich in ihm. »Mir fehlt da das Gegenüber, am Telefon. Eine Stimme im Hörer reicht mir nicht. Vielleicht weil das Telefon als Selbstverständlichkeit erst in mein Leben kam, als ich schon zwanzig war. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?« Der Mann steht auf, kramt ein Tempo aus der Hosentasche, schnäuzt sich vorsichtig, steckt das Taschentuch wieder ein. Er verschränkt die Arme hinter seinem Rücken, das richtet ihn auf. Von oben herab betrachtet er lange das grün-gelbe Rautenmuster ihres Krankenhauspyjamas. Ob sie dieses Muster genauso schrecklich finden würde, wie ich? Dann redet er weiter, seine Stimme klingt jetzt fester. »Du bist sicher mit Telefon aufgewachsen. Aber für uns in der DDR waren Telefone so etwas wie – wie Quantencomputer heute. Man konnte nicht einfach in den Laden gehen und so ein Ding kaufen. Telefon beantragen, das ging, aber dann hieß es: warten. Jahrelang warten. Wahrscheinlich vergeblich warten. Betriebe, Bonzen, Ärzte hatten Telefon. Und ein paar andere, aus undurchsichtigen Gründen. Glücklich, wer wen kannte, dessen Telefon man für dringliche Angelegenheiten mal benutzen durfte. Oder man ging zum Postamt und reihte sich in die Warteschlange ein für den Apparat dort, der in der schwarz lackierten Sperrholzkabine hing. Aber sicher nicht für Larifari-Privatgespräche. Mit wem auch? Es hatte ja kaum jemand Telefon. Eilige Nachrichten verschickten wir per Telegramm, so kurz wie möglich, jeder Buchstabe kostete. Ruth tot – Beerdig. Freit. 13 h – Keine Nelken!« Der Mann denkt an sein erstes eigenes Telefon, dieses glänzende Glück. Er sieht es genau vor sich. Das weinrote Plastikgehäuse mit den schwarzen Tasten. Es thronte nur drei Monate nach seiner Flucht auf dem Eichenfurnier-Tischchen, das er vor dem Hochhaus, in dem er damals wohnte, aus dem Sperrmüll gezogen hatte. Das makellos glänzende Gerät kam ihm vor wie ein Bote aus einer wundersamen Zukunft, die durch das schwarze Spiralkabel und die Löcher im Hörer unweigerlich in seine neue Welt hineinströmen würde. Er hoffte so sehr, dass die Kakerlaken, die nachts in seinem Einzimmerapartment herumkrabbelten, das Telefon mieden. Sauberes mögen sie nicht, hatte er von seiner Mutter gelernt. Er wischte sein Telefon jeden Tag mit einem weißen Antistatiktuch ab. »Es klingelte fast nie«, erzählt der Mann leise weiter und lächelt versonnen. »Aber es war jederzeit möglich und das zählte. Kannst du das verstehen, Bri --- Britta?« Der Mann zuckt zusammen. Ihr Name erschrickt ihn, obwohl er...