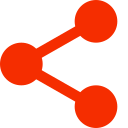E-Book, Deutsch, 256 Seiten, Format (B × H): 120 mm x 190 mm
Weil Leben mit dem Stern
1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-8031-4280-1
Verlag: Verlag Klaus Wagenbach
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 256 Seiten, Format (B × H): 120 mm x 190 mm
ISBN: 978-3-8031-4280-1
Verlag: Verlag Klaus Wagenbach
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
"Einer der herausragendsten Romane über das Schicksal der Juden unter den Nazis. Ich kenne keinen vergleichbaren." Philip Roth
Vielleicht hätte er doch auf sie hören sollen, auf seine Ružena, als sie zu ihm gesagt hatte: "Flieh Josi, du wirst ein furchtbares Leben haben."
Aber er hatte sich gefürchtet, über die Grenze zu gehen. Und jetzt saß er da, in seinem leeren Zimmer, im verlassenen Haus mit zertrümmertem Dach, in der Kälte, vor einem Topf mit Wasser, das nicht kochen will, den gelben Stern auf der Jacke.
Wie schon in "Mendelssohn auf dem Dach" erzählt Jirí Weil von der besetzten Stadt Prag. In diesem ergreifenden Roman geht er dem Schicksal des ehemaligen Bankangestellten Josef Roubícek nach, der von seiner bescheidenen Existenz in der einstmals blühenden Stadt träumt und nur noch in seinem Kopf lebt. Der Tod wird ihn nicht mehr vom Leben befreien können, denkt er, das Leben hatte ihn lange vergessen.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1
»Ružena«, sagte ich, »die Leute setzen sich an den gedeckten Tisch zu dieser Stunde, auf den Tischen stehen Vasen mit Blumen, und es klappern die Teller, und die Suppenschüsseln dampfen, die Leute beginnen zu speisen, schneiden das Fleisch mit dem Messer und nehmen die Stücke mit der Gabel auf, sie wischen sich den Mund mit der Serviette und trinken Bier, und dann pflegen sie zufrieden der Ruhe, überall um diese Stunde, in den Restaurants und bei sich zu Hause.« Ružena konnte mir nicht antworten, sie war nicht im Zimmer, war überhaupt nicht bei mir. Ich wußte nicht, was mit ihr geschehen war, hatte sie schon lange nicht gesehen. Vielleicht war sie überhaupt nicht mehr auf dieser Welt, vielleicht hatte sie überhaupt nie gelebt. Aber ich sprach mit ihr, ich mußte mit jemandem sprechen, ich kochte mir das Essen auf dem kleinen Kanonenofen, mir war kalt, weil das Öfchen die Mansarde nicht erwärmen konnte, Tür und Fenster schlossen nicht dicht, vergebens hatte ich versucht, sie mit alten Socken abzudichten, zweimal hatte ich auch schon das Ofenrohr gereinigt; ich war müde, verschmutzt und verzweifelt, ich hatte Hunger, und es war die Zeit des Mittagessens. »Ružena«, sagte ich, »jetzt trinken die Leute Kaffee, nun ja, vielleicht ist es kein echter Bohnenkaffee, aber sie sitzen im Warmen nach einem guten Mittagsmahl, und ich friere, Ružena, und habe Hunger.« Die Mansarde war voller Qualm, vielleicht von dem Ofen, vielleicht von den Zigaretten, die ich rauchte. Ich hatte sie mir selber gedreht, aus Ersatztee, es war so etwas wie Erdbeeroder Himbeerlaub, Hopfen vertrug ich nicht, ich wurde immer schläfrig danach, und mir tat der Kopf weh. »Ružena, jetzt zünden sich die Leute eine Zigarette an, stoßen den Rauch aus und hören Radio, das Mittagessen liegt schon lange hinter ihnen, und sie freuen sich auf die Nachmittagsjause, bald werden sie Kaffee mit Milch trinken und Hörnchen dazu essen, ach, wie lange ist es her, daß ich Hörnchen gegessen habe …« Ich mußte mit jemandem sprechen, ich war allein, ganz allein in der eiskalten Mansarde voller Mief und Qualm, ich mußte das Feuer von neuem entfachen, ich pustete in die glimmenden Späne und fürchtete, das Feuer könnte wieder erlöschen; ich hatte nur wenige Streichhölzer, war allein hier in dem kleinen Haus in der Vorstadt in einem schmuddligen Trainingsanzug. Neben dem Ofen lag eine Matratze, an der Wand in der Nische hingen mein Mantel und mein einziger Anzug. Ich hatte das Bett verbrannt und den Schrank, ich hatte alles Brennbare verfeuert, weil ich keine Kohlen hatte und weil ich ihnen nichts geben wollte – nein, sie würden nichts von mir bekommen, nicht einmal die alten Socken, mit denen ich Tür und Fenster abgedichtet hatte, nicht einmal die Gardinen, aus denen ich Scheuerlappen gemacht hatte, und auch nicht die Möbel, die schon längst der Ofen geschluckt hatte. Was ich mit der Matratze anfangen sollte, wußte ich noch nicht, irgendwie mußte ich ja schlafen, auf dem nackten Fußboden wäre es zu kalt. Ich wußte auch nicht, was ich mit dem Waschtisch machen sollte, er war aus hartem Holz, und ich hatte nicht mehr genügend Kraft, ihn zu zerhacken; er hatte eine Marmorplatte, die ich in den Garten geworfen hatte, damit sie zerspränge, aber sie war nicht zersprungen und erstickte jetzt das Gras unter sich. Die Matratze wollte ich erst verbrennen, wenn sie etwas mit mir unternähmen. Den Waschtisch müßte ich dann auch vernichten, und so würde schließlich nur das alte, wacklige Rauchtischchen übrigbleiben, ja, das hatte ich absichtlich noch nicht verbrannt, obwohl das ganz leicht gewesen wäre, es waren ja nur dünne Bambusstöckchen. Das Rauchtischchen mußte bleiben. Wenn sie kommen, um die Möbel zu beschlagnahmen, dann finden sie hier nur abgeblätterte Wände, eine leere Mansarde, ein Kanonenöfchen mit Sprüngen, und mitten im Zimmer wird das Rauchtischchen stehen; das einzige Möbelstück, das sich zu nichts eignet, wird Herrscher über das Zimmer sein. »Ružena«, setzte ich das Gespräch fort, »du hörst mich nicht, wahrscheinlich stopfst du um diese Stunde gerade Strümpfe, nimmst eine Masche auf oder denkst vielleicht über den Film nach, den du gesehen hast; es ist ein dummer Film, Ružena, es lohnt nicht, an ihn zu denken, es ist ein tschechischer Film über die Liebe und einen blauen Schleier, ich habe die Plakate gesehen und mir sogleich alles übrige hinzugedacht, dann sah ich auch irgendwo in einem Schaufenster Bilder aus dem Film, ein dickes Fräulein spielt darin eine Doppelrolle, manchmal lacht sie, und manchmal weint sie. Du solltest mir lieber einen guten Rat geben, wie ich auf diesem Öfchen hier mein Mittagessen kochen soll, das Feuer will nicht brennen, schau her, warst doch immer ein gescheites Mädchen und wußtest dir mit allem zu helfen. ›Flieh, Josi‹, hast du gesagt, ›du wirst ein furchtbares Leben haben, bist doch allein auf der Welt, und solchen Menschen geht es schlecht in diesen schwere Zeiten.‹« Ich bin nicht geflohen, fürchtete mich, über die Grenze zu gehen, hatte niemanden, der mit mir gegangen wäre, ich war allein, und niemand konnte mir einen Rat geben. Ich hatte Angst, sie würden mich an der Grenze schnappen, und außerdem wußte ich nicht, was ich in einem fremden Land anfangen sollte. Ich blies ins Feuer und schaute zur Decke auf; dort war ein feuchter Kreis, ein großer Fleck, der stetig wuchs. Zuweilen, bei starkem Regen, tropfte es von dort herunter; der Fleck war an der Stelle, wo das Dach ein Loch hatte. Ich kannte die Stelle, hatte selbst im Sommer dort mit dem Beil die Dachziegel zerschmettert, ich war allein im Hause gewesen und hatte gewollt, daß es in sich zusammenstürzte, ich hatte mir gewünscht, daß es in Trümmer fiele, bevor sie sich mit mir beschäftigten. Aber im Herbst, als es tüchtig zu gießen anfing, da war es schlimm, und ebenso im Winter, als Schnee auf das Dach fiel. Nun, das Wasser wollte und wollte nicht kochen, es waren Knochen darin, gute, große Knochen, ich hatte sie mit dem Beil zerkleinern müssen, damit sie in den Topf paßten, und ich hatte auch reichlich Fleisch von ihnen abgeschabt, daraus wollte ich mir Gulasch kochen. Ich hatte seit langem kein Fleisch mehr gegessen, ich sehnte mich leidenschaftlich nach Fleisch, stellte mir immer wieder vor, wie ich in einen Schweinebraten beiße, er hat eine knusprige Kruste, die auf der Zunge zergeht, oder ich werde mit den Zähnen Rindfleisch zerreißen, es wird ein großes Stück sein, und es wird ganz allein mir gehören. Aber ich hatte keine Fleischmarken, ich hatte auch kein Geld, um es schwarz zu kaufen, und ich wußte auch nicht, von wem ich Fleisch ohne Marken bekommen könnte. Ich hatte also nur Blut kaufen wollen, das durfte ich, daraus hatte ich mir immer eine Suppe gekocht, Blut war eben auch so etwas wie Fleisch. Ich hatte also vormittags im Fleischerladen gestanden, das Blut war anscheinend bereits ausverkauft, denn auf dem Block war nicht mehr der blaue Emailletopf zu sehen, aber ich blieb stehen, vielleicht hatte er doch etwas übrigbehalten, ich stand da, die Kanne in der Hand, und wartete. »Herr Halaburda«, sagte ich, »ist nicht noch ein bißchen Blut da?« »Nein, hab alles schon am Morgen verkauft«, erwiderte der. Er hackte dabei schönes Fleisch ab, ich schaute ihm voller Gier zu, so ein schönes, rotes Stück Fleisch, wie würde das wohl schmecken, kurz gebraten, ja, das war Steak, einst hatte ich es auch gegessen, Leutchen, ich sag euch, ich habe eine Menge Steaks gegessen … Ich lungerte im Laden herum und schaute zu, wie der Fleischer die Marken abschnitt und die Portionen verteilte. Ich wußte nicht, was ich am nächsten Tage kochen sollte, ich hatte mich auf das Blut verlassen, hatte sogar schon die Graupen gekocht, ich kann doch nicht trockene Graupen essen, wie oft hatte ich sie schon gegessen, aber jetzt, da ich mich schon so auf das Blut gefreut hatte, würde ich keine einzige Graupe hinunterkriegen. »Herr Halaburda«, sagte ich mit heiserer Stimme, »Sie wissen doch, daß ich am Morgen nicht einkaufen darf, und ich würde so gerne Blut kaufen.« »Wissen Sie was, ich verkauf Ihnen ein paar Knochen, Sie können sich eine Suppe draus kochen.« Ich freute mich über die Knochen, und ich sagte mir, daß ich mir ein wahres Festessen bereiten würde, denn es waren große, schöne Knochen, und es hafteten ganze Stückchen Fleisch daran. Ich ging nach Hause, legte die Knochen hin und machte mich ans Holzhacken. Ich mußte mir ein paar Späne abspalten, hatte mir zu diesem Zweck schon seit langem ein prasseldürres Brett vom Bett aufgehoben; es diente mir schon lange, ich hatte oftmals mit dem Beil hineingeschlagen, und dabei hatten mir die Hände gefroren, ich trug alte Wollhandschuhe, aus denen die Finger hervorlugten. Späne hatte ich aber immer gewonnen. Dann setzte ich mich nahe an den Ofen und stellte den Wassertopf darauf. Wasser war allerdings nicht mehr da, ich hatte es verbraucht, als ich mir die geschwärzten Hände gewaschen hatte, ich mußte also zur Pumpe gehen. Das Zuleitungsrohr hatte ich zerschlagen, im Sommer, gleich nach der Geschichte mit dem Dach, ich hatte mir damals gesagt, daß die Leute vielleicht in einem zerstörten Haus wohnen, aber niemals auf eine Wasserleitung verzichten würden, sie bestimmt nicht. Das Wasser war in der Erde versickert, es war sicher viel Wasser weggeflossen, aber schließlich handelte es sich ja nicht um mein Haus, und ich zahlte auch keine Wasserrechnung. Ich nahm die Kanne und ging an die Straßenecke zur Pumpe. Rings um sie war der Boden vereist, meine Füße gerieten ins Rutschen, und meine Hände brannten, als ich den Schwengel...