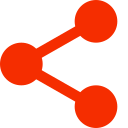Buch, Deutsch, 361 Seiten, PB, Format (B × H): 135 mm x 205 mm
ISBN: 978-3-86827-517-9
Verlag: Francke-Buchhandlung
eines kleinen Sohns, über den Weg läuft, ahnt sie nicht,
wie schnell sie Washington der Liebe wegen den Rücken kehren wird.
Nach einer Blitzhochzeit findet die frischgebackene kleine Familie ihr neues Zuhause am malerischen Moses Lake in Texas. Doch die Idylle trügt. Auf Firefly Island, einer verschlafenen kleinen Insel, verbirgt sich ein dunkles Geheimnis und schon bald ist Mallory froh über die Verbindungen, die sie noch nach Washington hat.
Zielgruppe
Fans zeitgenössischer Romane
Weitere Infos & Material
Kapitel 1
Wenn wir nicht mehr wissen, welchen Weg wir einschlagen sollen,
beginnt unsere eigentliche Reise!
Wendell Berry
(an der Wand der Weisheit im Fischköder- und Lebensmittelladen
Waterbird in Moses Lake, Texas, zitiert)
Es gibt Zeiten, in denen das Leben große Ähnlichkeit mit einem Cursor auf einer leeren Seite hat, der wie ein elektronischer Herzschlag rhythmisch blinkt und eine kurze Frage schreibt:
Wie.
Geht.
Es.
Weiter?
Die Zeit und der Raum und das Leben warten auf eine Antwort. Und eine leere Seite bietet viele Möglichkeiten.
Der Produzent von CNN will wissen, wie ich hier gelandet bin. War mir von Anfang an überhaupt bewusst, wozu das alles führen würde?
Der Cursor drängt mich zu einer Antwort auf diese Frage. Vielleicht will er mich auch nur herausfordern, mir zuzwinkern und mir leise zuflüstern: Komm schon, versuch es! Es klingt wie einer dieser abgedroschenen Witze, die sich einsame Reisevertreter in Hotelbars erzählen: Was haben eine Milchkuh, eine irische Liebeslegende und ein politischer Skandal gemeinsam?
Aber ich könnte diese Geschichte nicht erfinden, selbst wenn ich es wollte. Und erklären kann ich sie schon gar nicht. Es ist leichter, einfach aus dem Fenster zu schauen, die Skyline von Washington, D.C., zu betrachten, die jetzt irgendwie fehl am Platz wirkt und mir etwas vormachen will, wenn sie flüstert: Es ist Sommer, Mallory. Hier draußen ist es angenehm mild. Fühlst du es? Hörst du nicht, wie die Grillen zirpen und die Hühner die Junikäfer von der Veranda picken?
Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und tauche in eine andere Welt ein, die sich wie ein bequemes altes T-Shirt um mich legt – ein überdimensionales Shirt, das am Kragen ausgerissen ist und schon so oft gewaschen wurde, dass die Schrift auf dem Etikett nicht mehr zu lesen ist. Und der Aufdruck vorne auf der Brust besteht nur noch aus einigen Farbklecksen, die an einzelnen Fäden kleben.
Ich stelle mir vor, ich wäre zu Hause und nicht hier in Washington. Ich höre die Wellen des Moses Lake ans Ufer schlagen und fühle den Rhythmus des Sees unter meinen Füßen. Meine Augen fallen mir zu und ich genieße die nach Seewasser riechende Texasluft, den blühenden Oleander, das Trampeln kleiner, nackter Füße auf dem Flur und das Geräusch einer Schmusedecke, die über den Boden geschleift wird. Der honigsüße Duft eines Sommermorgens.
Ich kann es nicht erwarten, einen kleinen Jungen mit aufgeschlagenen Knien auf den Schoß zu nehmen, ihm durch seine zerzausten Haare zu fahren, die ersten, unschuldigen Atemzüge am Morgen zu hören, bevor ich dazu gezwungen bin, zu reden, Fragen zu stellen und es mit dem Rest der Welt aufzunehmen. Ich sehne mich nach all diesen Dingen, obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich sie mir je wünschen würde. Ich sehne mich nach dem Ort, der sich wie ein seidiges Spinnennetz still und leise, weich und doch stark, um mich gelegt hat. Ich bin davon gefesselt und spüre eine Zufriedenheit, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es ist wirklich sonderbar, wie schnell ein Leben zu unserem Leben werden kann, und wie sehr wir dafür kämpfen, wenn es uns jemand wegnehmen will.
Das Washingtoner CNN-Studio will die Geschichte in meinen eigenen Worten hören, damit der Moderator das Interview vorbereiten kann. Er will Details hören, die interessanten Kleinigkeiten, die die Zuschauer fesseln. Er will wissen, ob ich je geahnt habe, dass ich irgendwann hier landen würde. Er ist nicht der Erste, der mich das fragt. Für die Antwort auf diese Frage interessieren sich viele.
Für CNN macht man Dinge, die man für niemanden sonst tun würde. Man versucht, das eigene Leben wie eine Landkarte auszubreiten, und streicht sie glatt, damit nichts zwischen den Falten versteckt bleibt. Also setze ich mich an den Computer und versuche, zum Anfang zurückzukehren, mich über diese gefalteten Erinnerungen zu beugen und den Ausgangspunkt zu dieser ungeplanten Reise, die vor einem Jahr begann, in der hintersten Ecke der Landkarte zu finden.
Als ich Daniel Everson das erste Mal sah, stand ich etwas hilflos zwischen Papieren und Notizzetteln in der Halle des Kapitols und versuchte, in einem kurzen, engen Rock und hochhackigen Schuhen würdevoll in die Hocke zu gehen. Die Schuhe waren seriös genug, um lautstark zu verkünden: Ich meine es mit meiner Arbeit ernst, aber doch hoch genug, um gleichzeitig zu flüstern: Ich bin eine Frau. Hört ihr mich brüllen? Ich trug mein Lieblingskostüm, die perfekte Kleidung für ein Foto der Kongressmitarbeiter auf den Stufen des Kapitols.
Die Papiere, die über den Marmorboden segelten, standen in einem krassen Widerspruch zur ambitionierten Wahl meiner Kleidung. Sie verkündeten laut und deutlich: Diese Frau ist eine Idiotin.
„Hier sieht es ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.“ Die freundliche, tiefe Baritonstimme war nicht gerade das, was ich im Moment brauchen konnte. Und genauso unerwünscht waren ihre Worte. Scherze über Bomben auf dem Capitol Hill zeugen grundsätzlich von einem schlechten Geschmack, auch am frühen Morgen, wenn die Touristen noch nicht wie Heuschreckenschwärme über das Gelände hereinbrechen.
„Ich habe alles unter Kontrolle“, antwortete ich knapp und vielleicht ein wenig frostig. Ich reagierte immer noch höchst sensibel darauf, dass ich es möglicherweise dem Einfluss meines Vaters verdankte, dass ich die Stelle als Rechtsassistentin im Büro eines führenden Kongressabgeordneten bekommen hatte. Ich bewegte mich in der Hocke zur Seite, rutschte auf dem glatten Boden fast aus und schlug dann mit der Hand auf fünf Blätter des umfangreichen Gesetzesentwurfs für saubere Energie, der jetzt mit gelben Korrekturfähnchen und gekritzelten Notizen am Rand übersät war und überarbeitet, mühsam Korrektur gelesen und kopiert werden musste. Jetzt würde ich auch noch alles von Hand sortieren müssen, bevor ich mit der Bearbeitung anfangen konnte.
Ein Windstoß wehte durch den Flur – eine Folge der Renovierungsarbeiten im Gebäude – und ich hörte, wie die Papiere durch den weiten Schlund der großen Rundhalle segelten. Eine einsame Kirschblüte schlug in einem surrealen Zeitlupentempo neben mir einen Salto. Zwei Männer in dunklen Anzügen, die in ein angeregtes Gespräch vertieft waren, machten einen Bogen um mich, als wäre ich unsichtbar. Ein Blatt Papier wurde in die Luft geweht und blieb hinten an meinem Rock kleben. Ich griff danach und spielte ein seltsames Verrenkspiel, bei dem ich mit einer Hand die Papiere auf dem Boden festhielt und mit der anderen versuchte, das Papier zu fassen, das an mir klebte. Meine Finger schlossen sich im selben Moment darum, in dem ein weiteres Blatt an mir vorbeisegelte. Schnell nagelte ich es unter meinem zweiten Fuß fest.
„Bleiben Sie einen Moment so stehen.“ In der Stimme des Mannes lag ein freundliches, leises Lachen. Ich versuchte, seinen Akzent zuzuordnen. Vielleicht Michigan, möglicherweise auch New York. Er könnte auch Kanadier sein. Seine Stimme klang nett. Herzlich und gefühlvoll. Fast musikalisch. Er bückte sich und sammelte die verstreuten Papiere ein, die ich auf dem Boden festhielt. Ich malte mir aus, welches Bild er vor sich sah: Eine brünette Frau in einem engen Rock, die sich wie eine Riesenspinne auf dem Boden verrenkte.
Mir ging durch den Kopf, dass der Gesetzesentwurf frisch aus einer Besprechung kam und definitiv nicht für fremde Augen bestimmt war. Streng genommen war es meine Aufgabe, ihn zu schützen, und wenn der eigene, gerade erst pensionierte Vater sein Leben lang als Lobbyist gearbeitet hat, weiß man, dass immer Leute herumschnüffeln und auf eine undichte Stelle hoffen. „Nein, nicht nötig. Ich habe alles unter Kontrolle“, beharrte ich.
„Das sehe ich.“ Er zog die Papiere unter meinem Fuß hervor, schob sie zu einem Stapel zusammen und ging dann in die Hocke, um die Blätter auf den Boden zu klopfen, damit die Kanten ordentlich aufeinanderlagen. Als er sie mir reichte, schaute er mich an und lächelte dabei. Genauso wie in diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen hörte plötzlich die Welt auf, sich zu drehen. Ich hörte das ansteigende Crescendo der Geigen und Bläser, die im Kino eine solche Szene untermalen.
Daniel Webster Everson – ja, so hieß er tatsächlich, auch wenn ich das in diesem Moment noch nicht wusste – hatte die schönsten grünen Augen, die ich je gesehen hatte. Von dichten, schwarzen Wimpern umrahmt, schien aus ihnen ein inneres Licht zu leuchten, das fast außerirdisch war. Seine Haare waren gewellt und dunkel und so lang, dass sie sich über seinem Kragen kräuselten, was für Mitarbeiter im Kongress sehr unüblich war. Er trug einen Anzug. Der Anzug stand ihm sehr gut, wie ich sofort feststellte. Ein schwarzer Anzug mit einem hellblauen Hemd und einer ziemlich konservativen marineblau und grau gestreiften Krawatte. Ich fragte mich, was er hier machte. War er Lobbyist? Ein Tourist, dem es irgendwie gelungen war, sich vor allen anderen hereinzuschleichen? Ein Berater?
Ich fragte mich, wie jemand eine solche Augenfarbe haben konnte.
Vielleicht trug er farbige Kontaktlinsen.
War sein Vater Zigeuner?
Oder Schauspieler.
Er sah jedenfalls aus wie so jemand. Wie einer, der den Prinz von Persien oder den Piratenkönig oder den Jediritter spielte.
Ich überlegte, ob er verheiratet war.
Wollte er vielleicht heiraten? Irgendwann. Irgendwann in den nächsten zehn Jahren wäre in Ordnung. Ehrlich. Ich könnte warten.
Wohnte er in Washington, oder war er nur zu Besuch hier? Liebte er flauschige kleine Kätzchen und Kinder? Besuchte er sonntags seine Mutter? Waren die Locken auf seinem Hinterkopf echt? Hoffentlich hatte er keine dieser furchtbar altmodischen Männerdauerwellen, über die meine Freundin Kaylyn so gern lästerte.
Mochte er italienisches Essen? War er gar Italiener?
Er könnte Italiener sein.
Oder Baseballspieler. Ein Baseballprofi. Er sah sportlich aus. Die Kongressabgeordneten luden gern Profisportler für PR-Aktionen ein.
Im Geiste ging ich diese ganzen Fragen im Bruchteil einer Sekunde durch, bevor er mir die Blätter reichte, durch die Halle joggte, um den Rest einzusammeln, und sie mir mit einem Lächeln reichte, während ich mich wieder aufrichtete und versuchte, meine schmollende Unterlippe nach oben zu schieben. Ich suchte nach einer intelligenten Bemerkung, nach einem klugen Spruch, der verraten würde, dass diese Ungeschicklichkeit nur ein Ausrutscher war. Ich war keine dümmliche Büroassistentin, die nur wegen ihrer attraktiven Erscheinung und der umwerfenden Figur, die sie in einem engen Rock und in eleganten Schuhen machte, eingestellt worden war.
Aber ich konnte nichts anderes denken als: Wow! Und ich brachte nicht mehr als „Danke“ über die Lippen. Ich merkte, dass ich plötzlich rot wurde, und das sollte etwas heißen bei einer vierunddreißigjährigen Frau, die mit dem Leben in der Großstadt bestens vertraut war und die jegliche Beziehung zu Männern auf Eis gelegt hatte, um sich auf ihre politischen Ziele zu konzentrieren. Der zu diesem Zeitpunkt namenlose barmherzige Samariter war nicht der attraktivste Mann, den ich je gesehen hatte, wenigstens nicht im Sinne von männlichen Models in Werbekatalogen, aber trotzdem … passierte etwas. Ein Feuerwerk wurde entzündet, hätte meine Urgroßmutter wahrscheinlich gesagt. Mallory, hatte sie mich immer ermahnt und mit ihrem knorrigen Omafinger auf mich gedeutet. Eine kluge Frau begnügt sich nicht mit irgendeinem Mann, nur um einen Mann zu haben. Das ist, als kaufe man Schuhe, nur weil sie billig sind. Wenn sie dir nicht passen, hast du nichts davon.
Du musst auf ein Feuerwerk warten.
Uroma Louisa stammte aus der heiligen Stadt Charleston in South Carolina. Sie war die Einzige in der Familie, die aus den Südstaaten kam und allen anderen immer ein wenig ein Rätsel blieb. Sie liebte Plattitüden, die mit feuchten Augen vorgetragen wurden. In ihrem lang gezogenen, behäbigen Südstaatenakzent klangen sie entzückend und süß wie Pfirsichmarmelade oder Honigbutter. Sie glaubte an Feuerwerke und daran, dass Menschen füreinander bestimmt waren.
Ich hatte diese Vorstellung immer für reizvoll, aber leider überholt gehalten. Das änderte sich allerdings an dem Tag, an dem ich Daniel Webster Everson kennenlernte. Wie ein aufgeregter Schmetterling, der in einem Netz gefangen ist, flatterte mein Herz. Ich überlegte flüchtig, ob er das wahrnehmen konnte. In diesem Moment über dem chaotisch verzettelten Gesetzesentwurf für saubere Energie hatte ich das Gefühl, dass wir durch eine unsichtbare Macht, die wir beide zwar spürten, aber nicht sahen, zueinander hingezogen wurden. Er fühlte es. Ich wusste einfach, dass er es auch fühlte.
Doch dann zerschmetterte er meine ganzen Fantasiegespinste mit einem einzigen, brutalen Schlag. Seine Armbanduhr – eines dieser hässlichen, dämlichen Plastikdigitalteile mit tausend Tasten und Funktionen – piepste plötzlich. Er warf einen Blick auf die Uhr, lächelte freundlich, wünschte mir viel Glück und verschwand aus meinem Leben. Und ließ mich einfach stehen, leicht spreizfüßig und völlig sprachlos.
Ich stolzierte davon, jonglierte den Gesetzesentwurf wie ein unruhiges Baby auf den Armen und wusste nicht genau, ob ich mich abgelehnt oder vom Schicksal auf den Arm genommen fühlen sollte. Oder beides. Diesem Gedanken folgte eine leise, zarte Stimme, die Weisheitssprüche aus den unzähligen Selbsthilfebüchern aufsagte, die ich gelesen hatte, seit ich nach Washington gezogen war und versuchte, den Staub meiner letzten gescheiterten Beziehung von mir abzuschütteln. Es war die längste Beziehung gewesen, die ich je gehabt hatte, und der einzige Grund, warum ich zwei Jahre beruflich in einem schwarzen Loch im amerikanischen Konsulat in Mailand festgesessen hatte. Das letzte Dreivierteljahr dieser Zeit hatte ich damit verbracht, einen würdevollen Ausweg zu suchen, ohne die Hoffnung der anderen Beteiligten zunichte zu machen: seine Hoffnung, die Hoffnung meiner Familie und die Hoffnung seiner Familie.
Wenn man über dreißig ist und länger als ein halbes Jahr mit jemandem zusammen, meinen alle, dass er es sein müsste, dass jetzt der etwas verspätete Start in die Ehe-und-Familien-Phase im Leben kommen müsste. Aber einige Menschen sind einfach nicht für ein Vorort-Reihenhaus und eins Komma fünf Kinder geschaffen. Ich hatte immer gewusst, dass ich für eine Berufskarriere besser geeignet bin. Politik faszinierte mich. Ich genoss die Macht, das Gefühl, etwas zu tun, das die Welt verändert und das wichtig ist, die geheimen Vereinbarungen hinter den Kulissen. Genauso wie das U-Bahn-System, das das Kapitol mit den Bürogebäuden des Kongresses und des Senats miteinander verbindet, gab es in Washington versteckte Verbindungen und unterirdische Wege, und es machte mir Spaß, sie zu entdecken. Das war das Leben, für das ich bestimmt war.
Meine Mutter lehnte diese Vorstellung vehement ab. Sie war der Meinung, dass ich mir einen geeigneten Mann suchen sollte, besonders in meinem Alter. In Mutters Familie heirateten Frauen Macht; sie strebten nicht selbst eine einflussreiche Position an. Bei meinen vier älteren Schwestern hatte sie ihren Willen durchgesetzt, aber ich war diejenige, die anders war, die aus dem Schema ausbrach, die selbst Einfluss ausüben würde.
Aber während ich meinen Papierstapel sortierte und ihn wieder richtig zusammenfügte, musste ich an den Mann aus der Eingangshalle des Kapitols denken. Den Mann mit den grünen Augen und den dichten, jungenhaften Wimpern.
Ich fragte mich, ob ich auf dem Schicksalsweg falsch abgebogen war, als ich ihn wortlos hatte weggehen lassen. Das war natürlich ein dummer Gedanke. Er hatte kein Interesse an mir, sonst hätte er mich ja nicht wegen einer piependen Armbanduhr stehen lassen.
Als ich kurz in meine Wohnung fuhr, um mich umzuziehen, bevor ich den Abend im Fitnessstudio verbrachte, rief ich meine ältere Schwester Trudy an. Trudy war die Schwester, die mir altersmäßig am nächsten stand, obwohl sie immerhin fünf Jahre älter war als ich. Sie war neununddreißigeinhalb und versuchte, mithilfe einer künstlichen Befruchtung doch noch ein Kind zu bekommen. Sie brachte kein echtes Interesse an dem Mann in der Eingangshalle auf. Morgen hatte sie einen Arzttermin, dann würde sie erfahren, ob der letzte Befruchtungsversuch erfolgreich verlaufen war. Sie war also ziemlich angespannt.
„Vielleicht gehörst du ja zu den Leuten, die sechs Kinder auf einmal bekommen“, sagte ich und Trudy stöhnte.
„Wir wären schon froh, wenn wir ein Kind bekämen. Vielleicht auch zwei. Ich will einfach Mutter sein, verstehst du das?“
„Ja natürlich.“ Aber ich verstand es nicht. Vielleicht lag es daran, dass ich schon immer das Küken in der Familie gewesen war, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich um einen anderen Menschen kümmern und ihn versorgen könnte. Wenn man als Mutter versagte, landete man eines Tages in einer Nachmittagstalkshow und musste sich vor Millionen Zuschauern rechtfertigen. Trudys Leben verlief meiner Meinung nach recht gut. Sie hatte einen erfolgreichen Mann und eine Importfirma, aber das alles zählte für sie nicht. Sie wollte ein Baby, bekam aber keins, und von nichts anderem konnte sie sprechen.
Schließlich gab ich das Gespräch auf und brach zum Fitnessstudio auf. Meine wenigen Freunde, die ich hatte, waren hier – Singles wie ich, die nach Feierabend nichts Besseres zu tun hatten, als ins Fitnessstudio zu gehen. Wir hatten uns schlauerweise den Namen die Fitten gegeben. An den meisten Tagen machten wir zuerst Sport und saßen danach im Restaurant auf der anderen Straßenseite und aßen frittierte Zwiebelringe und Cheeseburger. Das klingt vielleicht irgendwie kontraproduktiv, aber wenn man Sahnekuchen isst und über berufliche Erfolge und Misserfolge spricht, als spiele man im Geschehen der Weltpolitik wirklich eine Rolle, hat man einfach nicht so sehr das Gefühl, in Beziehungsfragen eine Niete zu sein.
Ich erzählte Kaylyn von dem Mann in der Eingangshalle des Kapitols, nachdem sie etwas frustriert gestanden hatte, dass sich der Neue, auf den sie in ihrem Lieblingscafé ein Auge geworfen hatte, als Blindgänger erwiesen hatte. Verheiratet, drei Kinder. Perfekte Frau.
Sie atmete scharf ein, als ich mein Erlebnis im Kapitol erwähnte. „Oh, ich wette, er ist Ire“, seufzte sie. „Heute ist nämlich St. Patrick’s Day, weißt du.“
Meine Kuchengabel blieb auf halbem Weg zu meinem Mund in der Luft stehen, da ich nicht verstand, was das eine mit dem anderen zu tun haben sollte. Waren am St. Patrick’s Day mehr Iren unterwegs als sonst? Beschlossen sie, dass sie an diesem Tag plötzlich die geheiligten Kongresshallen besuchen könnten? „Aber er sah gar nicht wie ein Ire aus. Eher … wie ein Italiener vielleicht. Oder …ein Zigeuner. Ich glaube, er war ein Zigeuner. Oder ein schottischer Herzog.“
Kaylyn verdrehte die Augen. „Mach dich nicht über meine Bücher lustig.“ Kaylyn war hoffnungslos süchtig nach Liebesromanen. Wir kennen uns seit unserer Schulzeit und schon damals hatte sie die Nase immer in einem Buch stecken. Sie kannte die Namen – die echten Namen – der Männer, die als Cowboys, Ritter und Highland-Helden auf dem Cover der Bücher abgebildet waren.
„Das würde ich nie wagen.“ Ich stieß sie leicht mit der Schulter. Wie sollte ich mir das Recht herausnehmen, sie zu kritisieren? Wenigstens hatten die Menschen in Kaylyns Romanen Anstand. Im Gegensatz zu vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, verliebten sie sich, und dieser Zustand der Glückseligkeit hielt für den Rest ihres Lebens an. Die Kontakte zu einflussreichen Politikern konnten einen nach einer Weile zum Zyniker machen. „Ich finde es herrlich, romantisch zu sein.“
Kaylyn nickte zustimmend und zog ihre hübsche kleine Nase kraus. „M-hm. Hast du schon Der gezähmte Texaner gelesen?“
Ich war mir nicht sicher, ob ich ihr gestehen sollte, dass ich die Bücher, die sie mir geliehen hatte, noch nicht angerührt hatte. Auf der anderen Seite des Tisches schaute Josh mit seinen hundertvierzig Kilo Kaylyn mit liebeskranken Augen an. Obwohl sie ein gemeinsames Büro in einer Softwarefirma hatten, war sie einfach nicht in den armen Josh verliebt. Leider hatte er nicht die geringste Ähnlichkeit mit den athletischen Traumprinzen in ihren Büchern.
„Ich … ähhh … wollte damit anfangen. Es ist bestimmt eine …gute Geschichte“, versuchte ich mich herauszureden. Das war eine sehr wohlwollende Antwort.
Kaylyn war zufrieden. „Das habe ich dir ja gesagt.“ Sie nahm den Strohhalm aus ihrem Becher und saugte die Tropfen vom Ende ab, während Josh sie wehmütig beobachtete. „Warte nur, bis ich dir Seine irische Braut gebe. Das Buch ist ja so gut. Du weißt, dass zwei Menschen, die sich am St. Patrick’s Day treffen, füreinander bestimmt sind, nicht wahr? Deshalb habe ich gefragt, ob der Mann Ire war.“
„Das funktioniert also nur bei Iren?“ Ich zog eine Braue hoch, um ihr klarzumachen, dass ich nicht bereit war, mich auf irgendetwas einzulassen, das auf einem Taschenbuchroman basierte.
„Das funktioniert sicher bei jedem.“ Mit einem leisen Schnauben tauchte sie ihren Strohhalm wieder in ihr Glas. „Außer bei Zynikern. Amy Ashley recherchiert immer gründlich.“
„Wer ist Amy Ashley?“
Kaylyn fuchtelte mit der Hand durch die Luft, um mir zu signalisieren, dass ich jetzt gut aufpassen sollte. „Sie hat Seine irische Braut geschrieben. Schon fünfmal hat sie den Preis für die beste Liebesroman-Schriftstellerin des Jahres gewonnen. Den Stoff für ihre Bücher recherchiert sie immer sehr gründlich.“
Ich aß ein paar Erdnüsse und tat so, als beugte ich mich Amy Ashleys weisen Erkenntnissen. „Ist ja schon gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Mann wiedertreffe, ist eins zu einer Million. Ich habe ihn noch nie zuvor im Kapitol gesehen. Wahrscheinlich war er ein Tourist aus einem kleinen Dorf in Kanada. Jedenfalls bin ich kein Zyniker. Ich bin nur … Realist.“ Ist das so falsch? „Aber ich bin auch keine Irin, es spielt also wahrscheinlich sowieso keine Rolle. Ich denke, man muss Ire sein, damit die Sache mit dem St. Patrick funktioniert.“ Ich warf eine Erdnuss über den Tisch. „Was sagst du dazu, Josh?“
Josh schob sich die Erdnuss in den Mund und tat so, als denke er angestrengt nach. „Wir könnten eine Probe aufs Exempel machen.“ Er warf den Kopf zurück, breitete die Arme aus und sagte lächelnd: „Küss mich. Ich bin Ire.“
Kaylyn verdrehte die Augen nach oben und deutete mit dem Strohhalm auf mich. „Also gut, machen wir Nägel mit Köpfen! Ich wette …“ Sie faltete die Hände und legte zwei Fingerspitzen aneinander. „… meinen Jahresbedarf an Liebesromanen, dass du diesen Mann wiedersiehst und dass er dich einlädt, mit ihm auszugehen, noch bevor dieser Monat vorbei ist.“
„Die Wette gilt, Schwester!“ Lachend schlug ich ein. Normalerweise war ich kein Glücksspieler, aber bei dieser Wette konnte mir nichts passieren.
Auf der anderen Tischseite schüttelte Josh bedenklich den Kopf.
Er wusste, wie viele Liebesromane Kaylyn in einem Jahr verschlingen konnte.