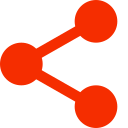E-Book, Deutsch, Band 3, 520 Seiten
Reihe: Sophia
Bomann Die Farben der Schönheit – Sophias Triumph
20001. Auflage 2020
ISBN: 978-3-8437-2233-9
Verlag: Ullstein HC
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Roman
E-Book, Deutsch, Band 3, 520 Seiten
Reihe: Sophia
ISBN: 978-3-8437-2233-9
Verlag: Ullstein HC
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
New York, 1942. Für Sophia bricht eine Welt zusammen, als ihr Mann sich nach einem Streit freiwillig an die Front meldet. Der Krieg in Europa schien so fern, auch wenn Sophia immer noch Freunde in Paris und Familie in Berlin hat. Sophia stürzt sich in die Arbeit, so gerne würde sie für die erfolgsverwöhnte Elizabeth Arden eine eigene Pflegeserie entwickeln. Oder ist für Sophia der Moment gekommen, sich selbstständig zu machen? Als ihr Mann in Frankreich als verschollen gilt und die Nachrichten aus der alten Heimat immer schlimmer werden, stellt sie alle Pläne zurück. Sie wird ihren Traum nicht aufgeben, aber für die große Liebe ist sie bereit, alles Erreichte zu opfern.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1. Kapitel
Juli 1934 Das Ticken der Uhr machte mich schläfrig. In diesem reizlosen weiß gestrichenen Raum, wo es außer ein paar braunen Sitzbänken keine weiteren Möbel gab, war ich die einzige Wartende. Gelangweilt spielte ich mit der alten Münze, die Darren mir bei einem unserer ersten Ausflüge geschenkt hatte und die ich an einer Silberkette bei mir trug. Als ich das Metall an meiner Haut spürte, dachte ich zurück an die Insel, die einmal die Heimat eines Piratenkapitäns gewesen war, und sehnte mich nach dem Duft der Meeresbrise und den Rufen der Möwen. Doch hier im Hospital gab es nur den Geruch von Desinfektionsmitteln, ferne Schritte und das zeitweilige Klappen von Türen. Mein Blick wanderte durch den Raum. Die Zeitung auf der Bank neben dem Fenster war von gestern. Die Artikel darin waren mir vertraut, denn Darren hatte das Blatt abonniert. An einer der Wände hing ein kleines Bild, das ein Segelboot zeigte. Ich hatte es in den vergangenen Tagen so oft angeschaut, dass ich jeden Pinselstrich auswendig kannte. Schließlich blickte ich zum Fenster. Ein Regenschauer hatte den Staub an den Scheiben in dunkle Schlieren verwandelt. Gerade versuchte das Sonnenlicht, sich seine Bahn durch die Wolkenberge zu brechen. Ich hatte schon hübschere Dinge durch ein Krankenhausfenster gesehen. Das Bettenhaus gegenüber wirkte grau und deprimierend. Große Fetzen Farbe waren von der Fassade abgeblättert. Die Feuerleiter, die es hier an fast jedem höheren Gebäude gab, war rostig. In Paris hatte es immerhin einen Garten gegeben, der um diese Jahreszeit in voller Blüte stand. Jeden Tag, an dem ich hier saß, dachte ich mindestens einmal an das Hôpital Lariboisière, wahrscheinlich, weil Henny mich dort besucht hatte. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass sich unsere Lage einmal umkehren würde. Henny war immer die Starke gewesen, die sich in allen Situationen zurechtfinden konnte. Sie hatte in Paris sofort Erfolg gehabt, hatte einen Geliebten gefunden und war aufgestiegen, während ich die arme Kirchenmaus war, die froh sein konnte, dass ihre Freundin sie unterstützte. Nun lag sie schon seit fast zwei Wochen hier, eine verarmte, kranke Frau, fern ihrer Heimat, die im Flur vor Darrens Wohnung zusammengebrochen war. Wie leicht hätte ich damals an ihrer Stelle sein können, damals, als mein Vater sich von mir losgesagt hatte. Wäre Henny nicht gewesen, hätte sie mich nicht bei sich in ihrer Berliner Wohnung aufgenommen, wäre ich möglicherweise irgendwo elend gestorben. Nun war es an mir, ihr zu helfen. »Miss Krohn?«, riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Sie klang dunkel und beruhigend, genau das Richtige, um Patienten die Angst zu nehmen. Langsam wandte ich mich zu der weiß gekleideten Gestalt um, die im Türrahmen stand. »Ja, Herr Doktor?« Er hatte mir bei unserem ersten Zusammentreffen seinen Namen genannt, aber der war mir entfallen. »Ihre Freundin ist jetzt wach. Wenn Sie möchten, können Sie gern zu ihr.« »Vielen Dank.« Ich erhob mich und griff nach meiner Handtasche. In meinem blauen Kostüm mit den dazu passenden Pumps wirkte ich wie eine Geschäftsfrau. Während meiner Besuche hatte ich festgestellt, dass ich zuvorkommender behandelt wurde, wenn ich förmlich gekleidet war. Ich schloss mich dem Arzt an und verließ den Warteraum. Higgins, fiel es mir ein, als wir die Stationstür durchquerten. Der Mann, dem ich folgte, hieß Dr. Higgins. Er hatte Dr. Miller abgelöst und war seit Anfang dieser Woche für Henny verantwortlich. Sein hellblonder Haarschopf war dicht und gepflegt, doch die dunklen Ringe unter seinen blauen Augen erzählten von der Mühsal seiner Arbeit, den langen Stunden an irgendwelchen Krankenbetten, den Begegnungen mit verzweifelten Patienten und deren Angehörigen. Vor der Tür von Hennys Zimmer machten wir halt. Sie hatte Glück gehabt, in einem Zweibettzimmer untergebracht zu werden. Dieses war eigentlich nur besser situierten Patientinnen vorbehalten. Doch ihre Krankheit verlangte eine gewisse Isolierung, außerdem waren die Krankensäle vollständig belegt. »Sie werden sich freuen zu hören, dass es Ihrer Freundin wieder etwas besser geht«, sagte Dr. Higgins. »Die Lungenentzündung zieht sich glücklicherweise weiter zurück. Zunehmende Sorgen macht uns allerdings die Opiumsucht. Wir dürfen ihr wegen der Lunge kein medizinisches Opiat geben, sonst würde die Gefahr bestehen, dass sie einen Atemstillstand erleidet. Allerdings kommt es als Folge des Entzugs immer wieder zu Angstzuständen und starken Schweißausbrüchen.« Ich starrte den Arzt an. »Wie wird es denn weitergehen?«, fragte ich. »Ich meine, sie muss doch von dem Zeug weg, nicht wahr?« »Natürlich muss sie das.« Eine Sorgenfalte zeigte sich auf der Stirn des Arztes. Er schien kurz mit sich zu ringen, dann antwortete er: »Es wird nicht ganz einfach werden. Opiate wirken auf das Gehirn. Angst, Wahnvorstellungen und Depressionen sind denkbar. Jetzt geben wir ihr Beruhigungsmittel, deshalb sind die Symptome nicht ganz so stark ausgeprägt. Sie sollte den Entzug unbedingt unter ärztlicher Aufsicht durchführen. Besser noch in einer Klinik. Es gibt Sanatorien, die speziell darauf ausgerichtet sind, Sucht zu bekämpfen. Ich könnte Ihnen einige Adressen geben. Allerdings ist der Aufenthalt dort nicht ganz billig.« Ein Schauer durchzog mich. Und gleichzeitig auch Wut auf Jouelle. Hätte er sie nicht mit dem Opium in Berührung gebracht … »Das wäre sehr freundlich von Ihnen«, gab ich zurück und verdrängte schnell den Gedanken. Über Hennys Geliebten und die Kosten für ihre Genesung konnte ich mir später noch Sorgen machen. »Danke.« »Okay, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ansonsten sehen wir uns morgen, nehme ich an?« Ich nickte. »Ja, wir sehen uns morgen. Vielen Dank, Dr. Higgins.« Der Arzt lächelte mir zu, wandte sich um und verschwand mit wehendem Kittel im Gang. Ich atmete tief durch, zog ein kleines buntes Tuch aus der Tasche und band es mir, wie es eine Krankenschwester mir geraten hatte, vors Gesicht. Dann klopfte ich. Ich wusste, dass Henny nur flüsternd antworten konnte, also wartete ich einen Atemzug und drückte die Klinke hinunter. An den Geruch der Desinfektionsmittel hatte ich mich bereits gewöhnt, doch der Minzduft überraschte mich jedes Mal ein wenig. Die Schwestern tropften etwas japanisches Minzöl auf Tücher, die sie neben Hennys Kopf legten. Das sollte ihr helfen, etwas besser durchzuatmen. Mich führte der Duft gedanklich sofort in die Fabrik von Madame Rubinstein zurück, an die langen Tische, an denen ich mit den anderen Frauen Kräuter zupfte und auslas. Seltsamerweise war mir das im Moment besser in Erinnerung als meine Zeit bei Miss Arden. Dass die Schönheitsfarm, die ich aufgebaut hatte, jetzt ohne mich lief, verletzte mich doch ziemlich, sodass ich es vermied, daran zu denken. »Hallo, Henny, wie geht es dir?«, fragte ich, während ich näher an sie herantrat. Nachdem ihre Nachbarin ausgezogen war, hatte man Hennys Bett ans Fenster geschoben. Die Aussicht war nicht besonders reizvoll, aber sie konnte wenigstens den Himmel sehen. Unter der Bettdecke wirkte meine Freundin zart und verletzlich. Ihre Wangen waren bleich, ihre Lippen rau, und ihre Augen wurden von rötlich blauen Ringen umgeben. Die Sucht hatte ihren Körper schon vor der Reise hierher ausgezehrt. Es war den Ärzten ebenso wie mir ein Rätsel gewesen, wie sie die Überfahrt überstehen konnte. Immerhin war der fiebrige Glanz aus ihren Augen verschwunden. Als sie mich sah, lächelte Henny. »Sophia«, brachte sie krächzend hervor. »Mir geht es furchtbar. Aber ich lebe noch, wie du siehst.« Sie lachte auf und begann sogleich zu husten. Zitternd angelte sie ein Tuch vom Nachttisch und presste es sich vors Gesicht. Ich trat vom Bett zurück, wie immer mit einem hilflosen Gefühl. Wie ich gelernt hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der Anfall vorüber war. Mir zerriss es das Herz, sie so zu sehen. Früher hatte sie vor Lebensfreude gesprüht, doch nun war die strahlende junge Frau kaum noch zu erkennen. Am liebsten hätte ich sie in die Arme gezogen, aber die Ärzte hatten mir von Umarmungen abgeraten. Nach einer Weile beruhigte sie sich wieder und lehnte sich erschöpft zurück. Ich zog mir einen Stuhl heran, blieb aber auf Abstand. »Weißt du noch, damals, als diese Spanische Grippe in der Stadt war?«, keuchte sie und ließ das Tuch langsam wieder sinken. »Das muss genauso gewesen sein.« »Es ist keine Grippe, die du hast«, gab ich zurück. »Außerdem meinte Dr. Miller, dass man nach einer Weile nicht mehr ansteckend ist. Und ich habe ja etwas vor dem Gesicht.« Damals, als die Seuche in Berlin grassierte, ließen uns unsere Mütter auch nur mit einem vorgebundenen Tuch aus dem Haus. Wir hörten die Nachbarinnen davon reden, dass wieder diese oder jene Familie betroffen sei, und draußen sahen wir, wie Leute mit Tüchern in die Straßenbahnen einstiegen. Unsere Lehrer sprachen in der Schule davon, und ab und zu belauschte ich meine...